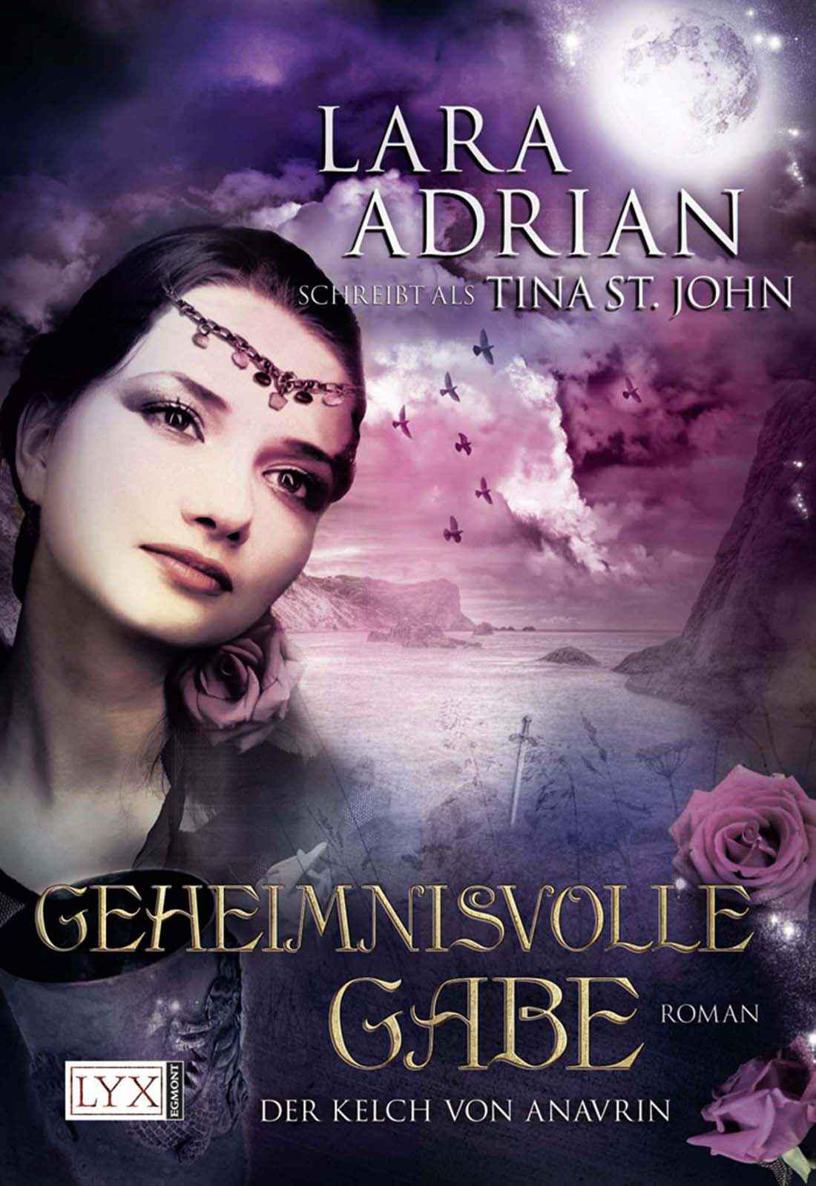![Der Kelch von Anavrin: Geheimnisvolle Gabe (German Edition)]()
Der Kelch von Anavrin: Geheimnisvolle Gabe (German Edition)
erst das fein geknüpfte Netz zur Begutachtung darbieten.
Rand schwieg, als er die kleine Aushöhlung an der Felswand erreichte. Er wartete vor dem schützenden Rund des Felsens, hatte er doch mit einem Mal das Gefühl, sich an einen heiligen Ort zu begeben, wenn er nur noch einen einzigen Schritt machte. Er lauschte ihrem leise gesummten Lied und sah, wie sie das Netz mit anmutigen Bewegungen dem Meer übergab. Beinahe lautlos tauchte es ins Wasser ein und sank. Die fein geknüpften Maschen wurden sogleich von den sanft rauschenden Wellen umspült. Zu Serenas Füßen verließ ein Schwarm silberner Fische blitzschnell das flache Wasser. Zwei größere Fische jedoch, die ein herzhaftes Mahl abgeben würden, verfingen sich im Netz.
Serenas Lied war nun nicht mehr als ein Summen, und sie achtete nicht auf Rand, als sie sich bückte, um den Fang aus dem Wasser zu ziehen. Sie griff nach den Enden des Netzes, führte sie zusammen und zog die Fische behutsam aus dem Meer. Das Wasser tropfte aus dem Netz, als sie es zu einem Korb trug, der im Schatten des Felsvorsprungs stand. Die Fische zappelten und verspritzten mit ihren ruckartigen Flossenschlägen etwas Wasser.
»Ich vermute, das wird unsere Abendmahlzeit.«
»Ganz recht«, erwiderte sie, wobei sie nur einen flüchtigen Blick für ihn übrig hatte. Ihre ganze Aufmerksamkeit – ihr Bedauern, wenn er ihren Blick richtig deutete – galt dem Fang.
Ernsthaftigkeit lag in ihren sonst so strahlenden Augen, als sie einen kleinen Dolch aus ihrem Gürtel zog, der aus gewundenem Leinen bestand. Mit einem leisen Seufzer streifte sie sich die Handschuhe ab und steckte sie in ihren Gürtel. Die Worte, die sie nun wisperte, waren zwar nicht zu verstehen, doch erklangen sie in einem Ton der Entschuldigung, als sie sich hinabbeugte und einen der beiden Fische packte. Das glitschige Geschöpf entwand sich ihrer Hand, kam indes nicht weit; die silbrigen Flossen schlugen in der Luft, als sich der Fisch in dem Netz am Strand von einer Seite auf die andere warf. Serena hielt den Atem an und erschauerte leicht, den Blick auf ihre leere Hand geheftet. Ihr Verhalten war ein merkwürdiges Spiegelbild ihrer Beute: Zu ihren Füßen rangen die Fische zappelnd nach Luft.
»Lass mich das machen«, sprach Rand und ging in die Hocke, um ihr die unangenehme Arbeit abzunehmen.
»Nein.« Sie wollte sein Angebot ausschlagen und zog die Stirn kraus. »Das muss ich zu Ende bringen. Ich möchte es tun.«
Doch Rand erlaubte ihr nicht, die Aufgabe zu übernehmen. Vielleicht lag es an seinem alten Eid, eine Dame vor jedem Übel zu bewahren – an seinem ritterlichen Ehrenkodex, der nun angeschlagen war und einer fernen Vergangenheit angehörte. Er erkannte rasch, dass sie nicht sonderlich erpicht darauf war, die Fische zu zerlegen, auch wenn sie ihren Willen kundgetan hatte. Ihr Gesicht war bleich vor Reue, obwohl sie das Kinn entschlossen vorreckte. Das, was er in ihren Zügen wahrnahm, war nicht der Ausdruck von Zimperlichkeit oder gar Ekel, sondern ein unergründliches Empfinden. Gewiss hatte sie bereits unzählige Male Fische gefangen, hatte sie das Netz doch geschickt und in geradezu zeremonieller Weise ausgeworfen. Nein, es war keine prüde Anstellerei, was sie im Innersten fühlte – da war diese Furcht, die sich in das Kobaltblau ihrer Augen geschlichen hatte.
»Lass mich das tun«, sagte er erneut und nahm ihr das Messer aus der zierlichen Hand.
Rasch war die Arbeit getan. Rand säuberte die Fische und warf die Innereien ins Meer zurück, sodass sich die Krebse und Möwen daran gütlich tun konnten. Dann legte er die Fische in den Korb, wusch sich die Hände und spülte das Messer in dem kleinen Strudel zu seinen Füßen ab. Als er sich wieder erhob, sah er, dass Serena ernst und schweigsam neben ihm stand. Sie hatte ihr Gesicht der offenen See zugewandt und hielt die Augen geschlossen. Und wieder waren ihre Hände, die sie wie zu einem Gebet gefaltet hatte, von den Lederhandschuhen bedeckt.
»Was tust du da?«
»Ich danke der See, dass sie uns Nahrung gibt. Ich danke den Fischen, die ich heute mit meinem Netz fangen durfte.«
Die Empfindsamkeit, die aus dieser Anschauung sprach, belustigte Rand. Doch es war klar, dass Serena aus tiefster Seele sprach. Als Kind hatte er gelernt, nur dem Allmächtigen für die täglichen Gaben zu danken. Zweifellos gehörte Serena einem älteren, heidnischen Glauben an, den die Kirche verbot und der nur noch von wenigen ausgeübt wurde. Rands Vorfahren
Weitere Kostenlose Bücher