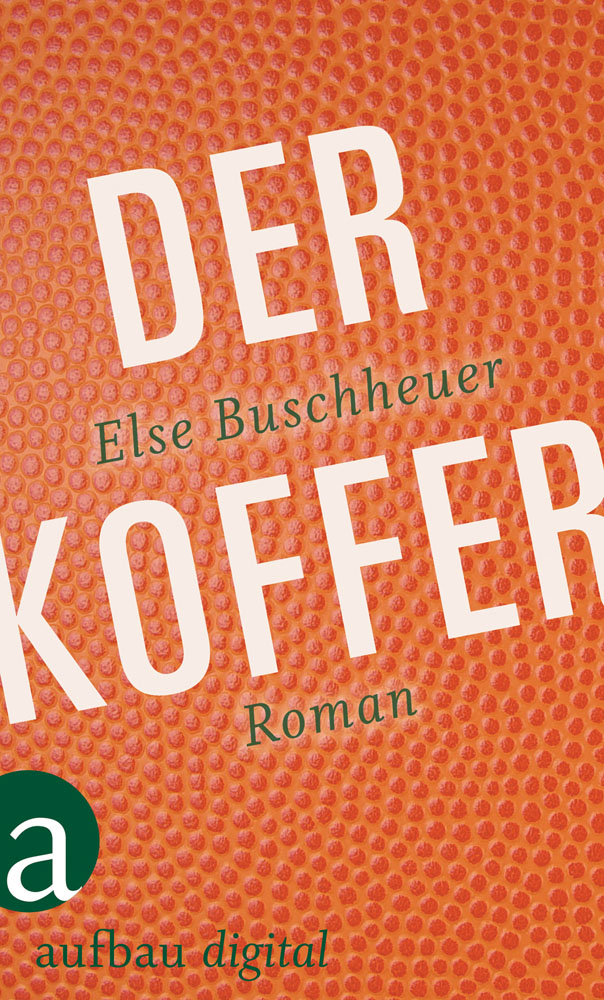![Der Koffer]()
Der Koffer
Wen anrufen? Wen jetzt anrufen?
Eine Telefonnummer fällt ihm ein, Zahl für Zahl, ohne dass er sie zuordnen kann.
»Wer ist da? Ellis? Ja … Rhett. Rhett Montiel.«
Es ist die Privatnummer seines Extherapeuten.
»Hast du Zeit? … Was, du hast schon geschlafen? … Es ist doch erst … Nein, morgen ist es zu spät. Ja, jetzt sofort … Es ist … ja … genau …ein Notfall.«
Rhett fährt den Broadway hoch. Er bewegt seinen Lincoln nur selten, nur ungern. Zur Uni fährt er immer mit der Subway. Früher war es ein Spaziergang durch den Central Park, vom Central Park West zur Columbia University, heute muss er größere Strecken zurücklegen. Es ist November. November ist sein Lieblingsmonat, vielleicht, weil der ebenso unentschlossen und umwölkt ist wie er.
Manhattan beginnt, sich für das Weihnachtsfest zu rüsten. Rhett duckt sich noch tiefer hinters Lenkrad vor der funkelnden Übermacht seiner Stadt, in der er untergeht wie einer von sieben Millionen Statisten, der eigens zu dem Zweck den Broadway hochfährt, um ein winzigerPunkt in der Lichterkette des urbanen Stop-and-go-Verkehrs zu sein.
Viel Verkehr für Viertel nach zwei Uhr morgens. Sie haben sich in Ellis’ Büro verabredet. Es ist an der 125. Straße, in dem achtzigstöckigen Bürogebäude, das vor einigen Jahren gebaut und gleich berühmt geworden ist, weil Bill Clinton hier einzog. Es erhebt sich – architektonisches Mahnmal der »Gentrification« – über die niedrigen Brownstone-Dächer Harlems.
Rhett ruft Sonnies Funktelefon an. Mailbox.
»Wo bist du? … Es ist schon spät … Ich suche dich … Melde dich …«
Harlem ist nicht mehr so verschrien wie in den Achtzigern, aber mitten in der Nacht gibt es doch wenig, an dem man sich festhalten kann, Vertrauen erweckende 24-Stunden-Supermärkte etwa, Tankstellen oder … andere Weiße. Er fährt ins Parkhaus und nimmt den Lift. Der Doorman, der Rhett an den Sarotti-Mohr erinnert, schläft.
»Hallo?«
Der Doorman schreckt auf.
»Regnet’s schon?«, fragt er.
Rhett schämt sich. Er ist schweißüberströmt. Sicher stinkt er.
Der Doorman telefoniert.
Er nickt.
Er weist Rhett den Weg zum Lift, den er doch kennt. Ellis empfängt ihn im Halbdunkel des verlassenen Büroflurs. Rhett fragt sich, was er hier soll. Er fragt sich, was er hier macht. Er hat vergessen, warum er hier ist. Er hat den Psychiater, den er vor einem Jahr gefeuert hat,nachts aus dem Bett geklingelt. Er schuldet Ellis einen Notfall. Rhett knüllt die Krempe seines Borsalinos in der Hand und folgt Ellis in dessen Büro. Ein Gewächshaus. Ein Glashaus. Nicht mit Steinen schmeißen, denkt Rhett. Bloß nicht mit Steinen schmeißen.
Als er im Schnittpunkt des Panoramas steht, fährt Manhattan ihm in alle Knochen.
Tagtäglich zwängt er sich zwischen den Wolkenkratzern hindurch, verirrt sich in ihnen wie in einem dunklen Wald, verliert sich im Straßengitter wie in einem Tagtraum, ohne sie zu sehen. Er weiß, dass sie da sind. Er vergisst, dass sie da sind. Nun, da er der Skyline in ihrer Totalität ausgesetzt ist, hat sie auf ihn die Wirkung intravenös injizierten Alkohols.
»Alles in Ordnung?«, fragt Ellis, der, da er dieser Droge permanent ausgesetzt ist, eine hohe Toleranzschwelle entwickelt hat. »Etwas zu trinken?«
»Manhattan«, stammelt Rhett und schließt die Augen. Es ist kaum vorstellbar, denkt er, dass nur zehn Meilen über uns alles Licht verlöscht. Über uns. Das »uns« gibt Rhett für einen Moment das Gefühl, dazuzugehören.
»Die Cocktailbar ist grade geschlossen«, sagt Ellis sarkastisch, »du trinkst doch nicht etwa wieder?«
Rhett schüttelt den Kopf.
»Gehst du noch zu den AA-Treffen?«
Rhett schüttelt den Kopf.
»Wasser?«
»Pepsi wäre schön.«
Ellis gießt Wasser aus einer Karaffe in ein Glas. Er geht zum Eisschrank und holt einen Eisklumpen heraus. Er zerhaut den Eisklumpen mit einem Eispickelund füllt das Eis mit der Hand in eine Schale. Kling. Kling. Kling.
Mit der Hand!
Ellis lässt sich auf seinem knarrenden Lederstuhl nieder, dessen Lehne ihn um zwei Köpfe überragt. Ein Kind spielt Psychiater.
»Du magst mich nicht, stimmt’s?«, sagt Rhett und entscheidet sich gegen Eis.
»Ist es wichtig, ob ich dich mag oder nicht?«
»Du glaubst mir nicht«, sagt er. »Du glaubst den Unfall nicht.«
»Ist das wichtig, ob ich dir glaube oder nicht?«
Rhett schweigt lange. Er nimmt das Glas und leert es in einem Zug.
»Ich glaube nicht, dass ich wen glücklich machen kann«, sagt
Weitere Kostenlose Bücher