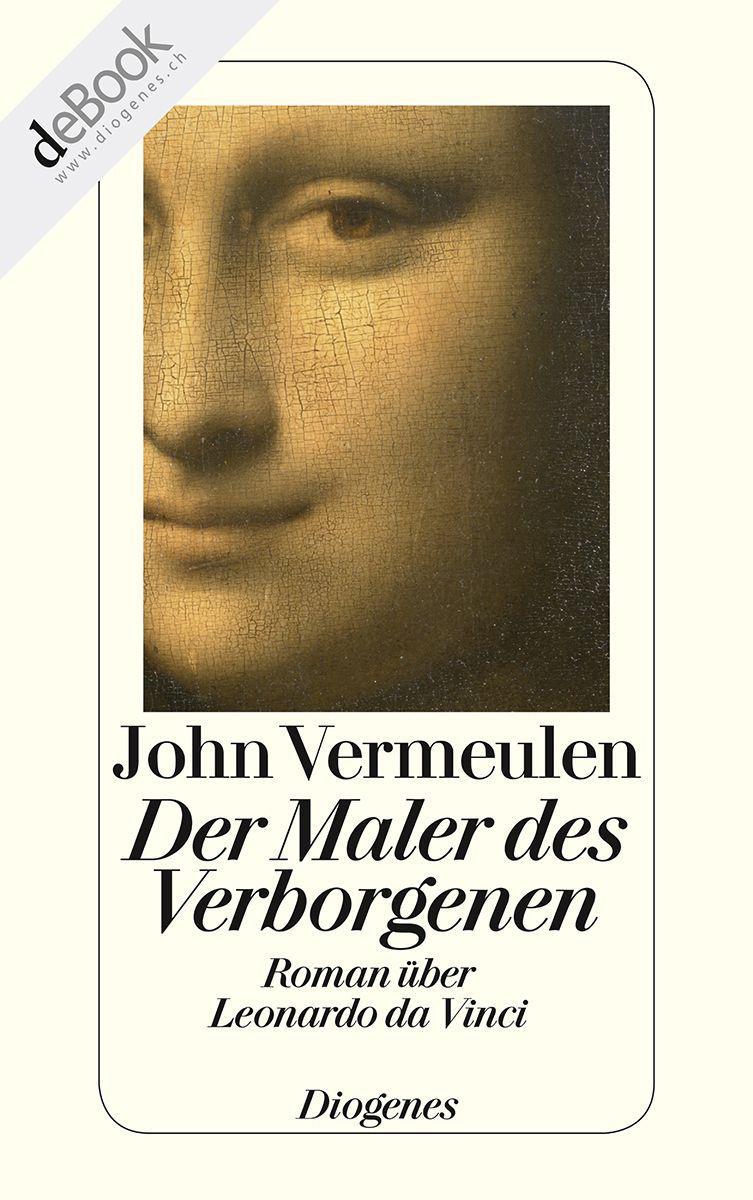![Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci]()
Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci
Wein über Wissenschaft und Kunst unterhalten.«
»Da kann ich wohl kaum nein sagen.«
»Solange du ein Fünkchen Anstand im Leib hast, wohl kaum«, sagte Alberti. Aber er lächelte. »Ich lasse dann noch von mir hören.«
Leonardo setzte sich wieder, ohne dem anderen nachzuschauen. Er wusste noch immer nicht so recht, was das zwischen ihm und Leon Battista Alberti war. Der Mann faszinierte ihn, er war nicht umsonst für sein Wissen, seinen Stil und seine Kultur berühmt. Auch konnte er in der Tat als wichtiges Sprungbrett in die höheren Kreise gelten. Doch wieso er sich ihm gegenüber so familiär gab, verstand Leonardo nicht.
Leon hat keine Kinder, vielleicht sieht er in mir den Sohn, der ihm verwehrt geblieben ist, dachte Leonardo, und diese Erklärung hielt er für annehmbar.
Die Frau, die er schon auf sie zukommen gesehen hatte, schlenderte jetzt langsam an ihm vorüber. Sie würdigte ihn keines Blickes. Die Kapuze ihres dunklen, kuttenartigen Gewandes verbarg ihr Gesicht. Nur eine weiße Haarsträhne lugte darunter hervor.
In Gedanken versunken schaute Leonardo der Frau nach. Das Gespräch mit Leon hatte schon teilweise vergessene Erinnerungen an seine Mutter geweckt. Erinnerungen, die er lieber verdrängte.
Er hatte immer noch keine Lust, in die Werkstatt zu gehen. Der Anblick der aufgeschnittenen Leiche schien ihm jegliche Energie geraubt zu haben, und sein Kopf fühlte sich dumpf an. Er erhob sich wieder, weit weniger flink als Alberti kurz zuvor, und ging stromabwärts zum Ponte Vecchio, um dort hinüber in die Stadt zu gehen.
Er hatte keine Mühe, die Via de’ Vasari zu finden, denn er war schon einmal dort gewesen. Damals war er die Straße ein paarmal hinauf- und hinuntergeschlendert, ohne den Mut aufzubringen, den Töpferladen von Addas Mutter zu betreten. Er konnte sich diese Scheu nicht recht erklären. Vielleicht war er sich unsicher, was er hier überhaupt suchte. Dass es nicht so sehr mit Adda zu tun hatte, war ihm freilich klar. Sie war eine reizende junge Frau, aber viel mehr auch nicht. Wenn er jemanden wiedersehen wollte, dann ihre Mutter. Um sich zu überzeugen, ob die Wirklichkeit mit der Erinnerung übereinstimmte, die er an sie hatte. Denn er war sich sicher, dass er sie malen wollte. Dereinst. Wenn sein Können und sein Wissen ausreichten, um Bilder zu schaffen, die stärker waren als das sichtbare Leben selbst. Denn einfach nur lebensnah zu malen oder zu zeichnen war für ihn bloße Nachahmung. Welchen Sinn sollte es haben, die Dinge so wiederzugeben, wie jedermann sie sehen konnte? Es war Sache des Künstlers, Geheimnisse herauszuarbeiten, die dem ahnungslosen Auge normalerweise entgingen, so seine Auffassung. Künstler, die das nicht konnten, waren jämmerliche Versager.
Diesmal schritt Leonardo resolut auf den verlassenen Laden zu und öffnete die Tür. Das Glöckchen über der Tür bimmelte hoch und melodisch, während er eintrat. Er blieb stehen, die Augen erwartungsvoll auf die blaugestrichene Tür hinter dem mit Tonwaren vollgestellten kleinen Ladentisch geheftet.
Die Tür öffnete sich, und Adda sah ihn zunächst erstaunt und dann sichtlich erfreut an. »Das ist aber eine Überraschung!« Sie wandte sich um und rief ins Haus hinein: »Mutter, Leonardo ist hier!«
Als die Mutter hereinkam, konnte Leonardo feststellen, dass sein Gedächtnis ihn nicht getrogen hatte. Sie war genauso schön wie auf dem Bild, das er sich von ihr bewahrt hatte. Er war froh darüber, denn er hatte Angst vor einer Enttäuschung gehabt. Nur das Sakrale von einst schien abhandengekommen zu sein. Doch das war natürlich durch die Grotte erzeugt worden, wie er sich sogleich bewusst machte. Die magische Aura war dort schon immer unsichtbar vorhanden gewesen, und diese Frau hatte sie aufleben lassen. Das Sakrale war im Übrigen nicht verloren, denn er trug es im Geiste bei sich, als eines dieser Geheimnisse, die nur ein Künstler wahrnehmen konnte.
»Meine Tochter hat mir erzählt, dass sie dir begegnet ist«, sagte sie lächelnd. »Ich hätte dich schon viel früher hier erwartet. Aber du hast wohl viel zu tun, nehme ich an.« Sie machte eine einladende Gebärde. »Bleib doch nicht dort stehen, komm herein.«
Die Wohnstube war klein, aber da nur wenige Möbelstücke darin standen und viel Licht durch ein hohes Fenster in der hinteren Wand hereinfiel, wirkte sie trotz des in zwei Ecken aufgestapelten Tonzeugs in allerlei Formen und Größen nicht beengt.
»Du darfst mich Magdalena nennen…
Weitere Kostenlose Bücher