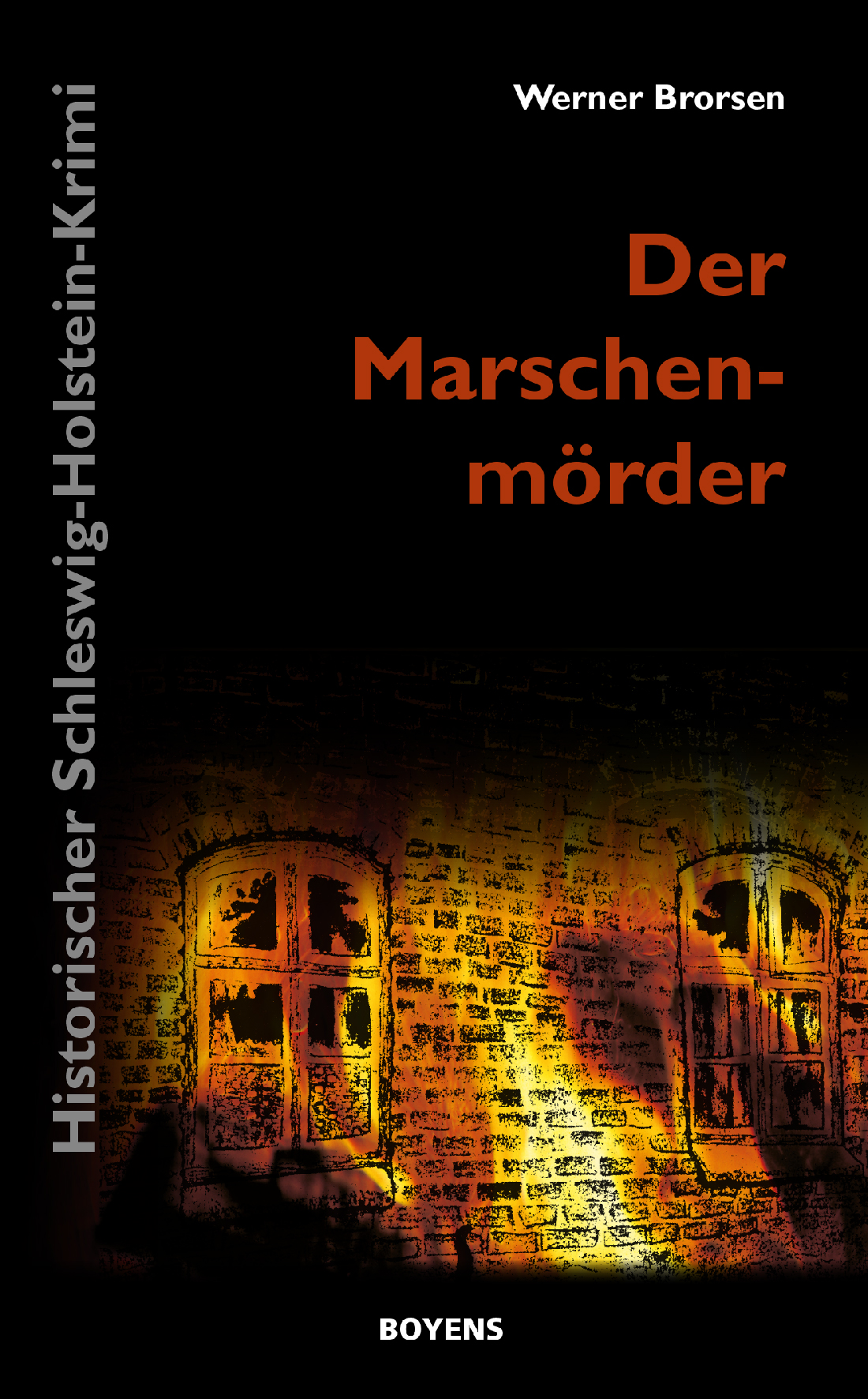![Der Marschenmörder]()
Der Marschenmörder
nervös nach einer Zigarre. „Jakob Schwarzkopf hat ihm eine Unterkunft in Sude besorgt. Bei einem Freund, dem Bauernvogt Jens.“
Jacobsen bleibt misstrauisch. „Ohne jegliche Aufsicht?“
„Nicht ganz“, erwidert Rötger. „Wir werden Jens instruieren. Ihn bitten, ein Auge auf den Bengel zu haben. Und uns mitzuteilen, wenn er verdächtigen Besuch bekommt.“
Umständlich zündet er seine Virginia an, lehnt sich in den Schreibtischstuhl zurück. „Sie sehen, ganz frei ist er nicht. Eher ein Vogel im goldenen Käfig. Mit begrenztem Auslauf. Denn an sein Vermögen kommt er nicht ran. Das wird weiterhin von Schwarzkopf verwaltet. Und auf den ist Verlass.“
19
Sude, hart am Stadtrand von Itzehoe gelegen, ist ein beschauliches Dorf mit 300 Einwohnern. Entstanden als Gemeinde freier Bauern, Fischer und Händler, kam es im Jahr 1408 in den Besitz des adligen Itzehoer Nonnenklosters. Es besteht aus 40 Wohnhäusern und zehn Bauernhöfen, die von Hufnern bewirtschaftet werden. Sie sind abhängig von der seit der Reformation evangelischen Klosterobrigkeit, der sie Hand- und Spanndienste leisten und Contribution zahlen müssen.
Weil das nicht selten zu Unstimmigkeiten und Spannungen führt, bedarf es einer starken, ausgleichenden Persönlichkeit als Mittelsmann und Verfechter der bäuerlichen Interessen. Und die sind bei Jacob Jens in den besten Händen.
Sofort stimmt der Bauernvogt zu, als sein alter Bekannter Jakob Schwarzkopf ihm die Aufnahme des jungen Thode vorschlägt. Er kennt das Schicksal der Thode-Familie, ahnt aber nichts von einem Verdacht gegen Timm. Selbst als Schwarzkopf ihn bittet, den Justizrat Rötger zu benachrichtigen, wenn sein neuer Hausgenosse fremden Besuch empfängt, stutzt er nur kurz und entgegnet lachend: „Dor pass ik för op, dat he keen Froonslüüd in’t Huus sleept.“
Vom ersten Tag an fühlt sich Timm im neuen Domizil zu Hause. Schon, dass er wieder auf einem Bauernhof lebt, gibt ihm Sicherheit und Vertrauen. Dem Hausherrn bietet er sogar an, ihm nach Lust und Laune bei der Arbeit zur Hand zu gehen. Doch überwiegend führt er das Leben eines wohlhabenden Nichtsnutzes.
Vom besten Schneider der Stadt lässt er sich einen Dreiteiler nach der neuesten Mode fertigen, sucht zweimal wöchentlich den Barbier auf, kauft sich eine teure Spieluhr und abonniert die Itzehoer Nachrichten. Auf seinem täglichen Spaziergang benutzt er einen Gehstock mit Silberknauf. Sonntags diniert er im feinen Itzehoer Café du Nord, und auf dem Heimweg kehrt er beim Gastwirt Klaus Voss in der Suder Dorfstraße ein.
Um „Kleingeld“ muss er sich nicht sorgen. Jakob Schwarzkopf hat Kost und Logis für ein Vierteljahr vorausgezahlt und lässt ihm, je nach Bedarf, monatlich 150 bis 300 Taler zukommen. Nachdenklich vergleicht Timm das Taschengeld, das Schwarzkopf scherzhaft Apanage nennt, mit den 63 Talern, die ihm der Hofbesitzer Wiedt in Pinnebergerdorf für ein halbes Jahr Knechtsdienst zahlte.
Dennoch ist er unruhig und oft nervös. Nicht sein Verbrechen bedrückt ihn, den Meister des Verdrängens. Doch erkennt er widerstrebend die sinnlose Leere seines Daseins. Er wagt nicht, Jakob Schwarzkopf gegenüber sein Unbehagen zu erwähnen. Als sich aber der Vormund nach seinem Befinden erkundigt, antwortet er entschlossen: „Ik koop mi eenen Hoff. Op de Stell.“ Und fügt in der Art eines um eine Kleinigkeit bittenden Kindes hinzu: „Dat mutt keen grooten ween. Twee Peer, een poor Köh, föftein bit twinnig Schaap …“
Jakob Schwarzkopf legt besänftigend seine Hand auf Timms Arm und erinnert ihn daran, dass das auf 120 000 Taler geschätzte Vermögen dem Alleinerben erst nach dem Abschluss der Ermittlungen zur vollen Verfügung steht.
„Wolang schall dat denn noch wiedergahn?“, fragt Timm ungeduldig.
Der alte Bauer stellt mit leichtem Erstaunen fest, dass eine Spur Angst in Timms Stimme mitschwingt, und versucht ihn aufzumuntern: „Du muss di nich opregen. Rötger un Joggobsen sünd twee Düchdige. De kriegt de Bandiden. Ook wennd’t noch ’n Wiel duert.“
20
„Machen wir uns nichts vor.“ Hans Peter Jacobsen schlägt mit der Hand auf den Aktenberg. „Wir sind am Ende. Und stehen vor dem Nichts. Nach fast acht Monaten Schufterei.“
Friedrich Rötger wirft einen Blick auf den Wandkalender: 25. März 1867. „Tscha. So ist es. Und deshalb beenden wir die Sache.“
Vor Tagen schon hat er den Entschluss gefasst, hat nur abgewartet, bis sich der Kollege von sich aus
Weitere Kostenlose Bücher