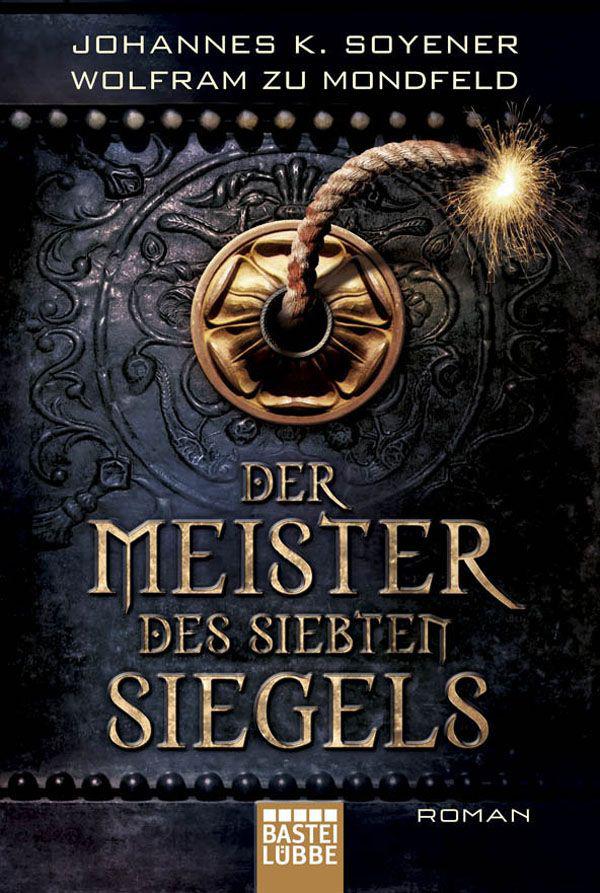![Der Meister des Siebten Siegels: Roman (German Edition)]()
Der Meister des Siebten Siegels: Roman (German Edition)
gewesen. Ich hab’ ihm gesagt er soll schreiben, daß er bereit sei, auch die vom Kaiser gewünschten Geschütze in Innsbruck zu gießen. Außerdem hat er doch noch nie ein separates Dienstgeld von irgend jemand bezogen – was eh schon Dummheit genug ist! Schreib dem Erzherzog außerdem, hab’ ich ihm gesagt, daß du das Glocken- und Büchsenhandwerk betreibst als unser Handwerk, Pflug und Wagen, mit dem du uns ernähren müssest! Der Herr, du wirst es nicht glauben, Adam, ist sich damals fast zu fein gewesen, diesen Brief zu schreiben. Mit dem Gießerlohn war es dasselbe, ebenso mit dem Abzug von nur einem Zentner Abgang im Feuer pro zehn Zentner Metall.«
»Was bedeutet das?« versuche ich ihren Redefluß zu unterbrechen. Vergeblich!
»Mein gutes Vermögen war’ heut schon längst dahin, angesichts der laufenden Münzverschlechterungen, wenn ich nicht ständig meine Augen offen hätte!«
Gleichzeitig leckt sie den Löffel gewissenhaft vorn wie hinten ab, wischt sich mit dem Handrücken den Mund, greift meinen inzwischen ebenfalls leeren Teller und trägt zu meiner Überraschung die Teller selbst in die Küche hinaus. Antonia stürzt ihr entgegen, wird aber mit der lauten Bemerkung: »Alles, aber auch alles muß ich selber machen!« zurückgescheucht.
Diese Offenheit habe ich nicht erwartet. Warum macht sie mich schon in der ersten Stunde unserer Begegnung mit den Zuständen von Büchsenhausen in dieser Art vertraut? Ist sie mit mir gleich von Anfang an so einverstanden, daß sie mich derart in ihr Vertrauen zieht?
»Neue Teller sind noch keine da!« keift Frau Elisabeth in der Küche Antonia an. Zurück ins Zimmer bleibt sie auf der Schwelle zur Küche stehen und redet weiter, als hätte sie nie aufgehört:
»Im Grunde hab’ ich mir das alles selbst zuzuschreiben; geschieht mir nur recht. So, jetzt aber das Hennele. Schau mal, Adam, das hast du noch nie gesehen. Stimmt’s? So was kriegst du hier nirgends. Mhm, das ist was ganz Feines!«
Sie zeigt mir Hähnchenteile mit Zwiebeln, die auffällig mit grünen Körnern bestreut sind. Das zerteilte Hennele schwimmt in einer Rotweinsoße.
»Das hast du noch nie gesehen – die grünen Körner, meine ich!« belehrt mich die Stimme der Herrin.
»Was ist das?« frage ich widerwillig zurück.
»Das sind Pfefferkörner!« lächelt triumphierend das Gesicht zu mir herab.
»Aha, Pfefferkörner …«, tue ich verwundert.
»Ich habe sie vom Markt mitgebracht. Nicht einfach, an das Gewürz heranzukommen. Weißt du, Adam, da muß man sich ganz genau auskennen. Ich habe von dem Gewürz schon seit längerem gehört und kenne da einen Händler; aber ohne mein Geschick wären die nie nach Innsbruck gekommen. Direkt aus Venedig hat er sie für mich mitgebracht. Ein Wunder, daß die überhaupt über den Brenner geschafft werden konnten, bei den Zuständen an der Grenze; zudem sind sie sehr, sehr teuer. Aber ich habe sie ihm günstig abgekauft. Man muß es halt nur können mit den Händlern. Pfeffer ist sehr rar, denn Räuberbanden fangen von Verona bis herauf zum Brenner alles ab – garantiert sind sie nächste Woche schon wieder teurer. Das weiß ich alles vom Händler; er hat es mir erzählt – mir ganz allein. Aber ich hab’ ja immer Glück – für die anderen. Stell dir vor: Pfefferkörner von Afrika über Venedig nach Innsbruck.«
Frau Elisabeth teilt mir die Körner, die auf dem Fleisch liegen, genau zu, indem sie mit der Messerspitze versucht sie abzuzählen. Daß Pfeffer aus Indien kommt, verschweige ich höflich.
Das Essen ist wirklich gut. Mit dem Brot tunke ich den letzten Rest Soße auf, wische mein Messer am restlichen Brotkanten ab, trinke den letzten Schluck Traminer hinterher und sehe, wie Antonia mich durch den Türspalt beobachtet.
»So, Adam«, sagt Frau Elisabeth und hebt dabei energisch den Kopf. »Du bist sicher müde von der Reise. Leg dich hier auf die Bank und ruh dich ein wenig aus, bis es zum Abendbrot soweit ist. Ich habe Arbeit, bin schon wieder zu spät dran!«
»Danke!« sage ich zu ihr und merke, als sie das Eßzimmer zum Gang hinaus verläßt, daß ich mit Antonia plötzlich allein bin. Auch sie bemerkt die plötzliche Zweisamkeit, vermeidet es aber, mich anzusehen, als sie mir eine schwere Decke aus Roßhaar reicht. Auch mir fällt es schwer, sie anzusehen. Gerade in diesen Stunden sehne ich mich nach Geborgenheit, Zärtlichkeit – macht mich die Einsamkeit und der Verlust meiner Frau krank. Ich zwinge mich, wegzusehen, als sich
Weitere Kostenlose Bücher