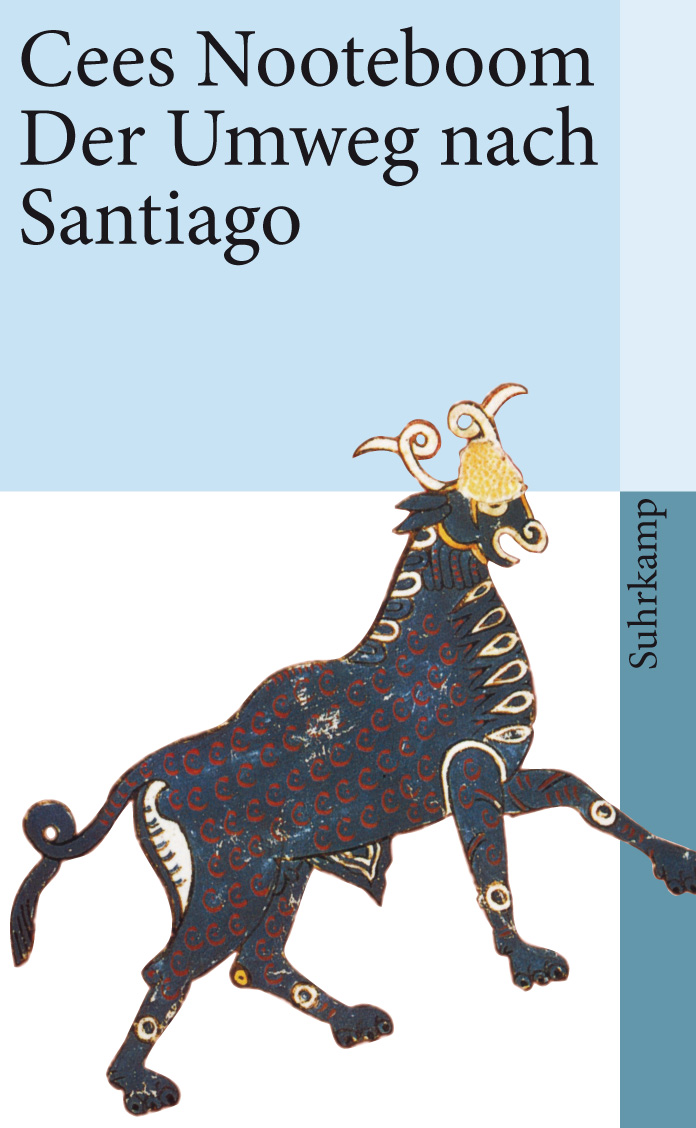![Der Umweg nach Santiago]()
Der Umweg nach Santiago
Blazers. Ich leere das Glas in seinem Gedenken, schmecke den Rost und gebe ihm recht und spaziere die Auffahrt zum Parador Richtung Friedhof hinunter. Von dort hat man einen Blick aufs Meer und auf den Teide in der Ferne, dort liegt es sich gut. Aber warum heißt jemand an diesem meerumwehten Fleck Walkiria? Und doch hieß sie so, Doña Walkiria Arteaga Herrera. Liebte ihr Vater Wagner? Keine Antwort. Warum hat Señorita Carmen O. Fernandez Padilla nie geheiratet, obwohl sie doch 56 geworden ist? Ihre Mutterund ihre Brüder werden sie nie vergessen. Nie? Und war Don Rafael Oliver Padilla, Sargento de la Guardia Civil, ihr Vater? Er ist immerhin 78 geworden. Die emaillierten Fotos aus dem Totenreich geben keine Antwort. Einige Kreuze sind schief, zerbrochen, umgefallen. Auf den meisten kann ich die Namen nicht mehr lesen. Die Erde ist rot. Die Blumen sind aus Plastik. Der Ozean ist groß. Der Tod ist nichts, oder ganz wenig.
Die Sonne muß irgendwo hinter mir, und auch noch ohne meine Erlaubnis, untergegangen sein, doch der Mond hängt am selben Seil und wird nun, so voll wie eine Sonne und fast rot anzusehen, über den sanften Hang des Vulkans gegenüber gezogen. Da bleibt er für einen Augenblick liegen, als hätte er noch keine Lust. Was ich jetzt sehe, ist dies: den Weg zu meinen Füßen, dann eine Böschung, dann die Kaserne des 49. Infanterieregiments, dann den Ozean im Mondenschein, hinreißend, dann den Teide, und an seinem sanften Hang den Himmelskörper, der sich jetzt unziemlich schnell hochheben läßt und gleichzeitig versilbert wird und zu leuchten beginnt. Jemand, der es nicht kann, bläst auf einer Trompete, und das wirkt, zu dieser Stunde und an diesem Ort, sehr rührend. Sonnenuntergang, aufsteigender Mond, Fanfarenstoß unter dem Abendhimmel, militärische Schritte auf dem Asphalt, die Toten drehen sich in ihren Gräbern um, Kinderstimmen steigen aus dem barranco auf, die dunkel gewordenen Flanken des Berges hinter mir bewegen sich sanft, aber das sind Schafe. Friede! Friede und Grillen, die kodierte Berichte senden über Früher und Jetzt.
Es gibt auch menschliche Grillen auf der Insel, aber die zirpen nicht, sie pfeifen. Die Verständigung von einem tiefen Tal zum nächsten war so schwierig, daß die Gomerianer, falls man sie so nennen darf, eine eigene Pfeifsprache, das silbo , dafür entwickelt haben. Gelehrte haben sich bereits im vorigen Jahrhundert damit beschäftigt, jemand hat ein Buch darüber geschrieben ( El Silbo Gomero, análisis lingüístico , von Ramón Trujillo), in dem neben ungewöhnlich schlechten – und daher so beeindruckenden – Fotos der erschreckenden Höhen, über die hinweg gepfiffen werdenmußte, auch eine Art von Röntgenbildern der gepfiffenen Wörter stehen, Schallwellen, die phantastische abstrakte Zeichnungen ergeben, nur daß nichts Abstraktes an ihnen ist, denn diese seltsamen östlichen Schriftgebilde stehen für äußerst konkrete Worte wie Der Felsen, Der Tisch und Die Messe. Die bekanntesten silbadores sind heute noch Don Gilberto Mendoza Santos, Don Olivier Gonzalez Hernandez und Don Vicente Herrera Ramos, und auf entsprechende Bitte sind diese menschlichen Vögel bereit, ihre elementaren Botschaften in dieser Sprache vorzupfeifen, die nun wohl bald aussterben wird.
Was nicht aussterben wird, ist das geographische Problem Gomeras an sich. Schon gleich hinter San Sebastián gelangt man in eine hohe, steinige, abweisende Landschaft, in der nichts wachsen kann. Stein. Erst oben, im Nationalpark Garajonay, verändert sich die Landschaft, dann aber auch gründlich. Häufig herrscht dort tagsüber dichter Nebel, man fährt durch ein Nibelungenland, begleitet vom Gesang der Scheibenwischer, und dann durch die schärfsten Haarnadelkurven, die man in seinem Leben gemeistert hat, auf der anderen Seite der Insel wieder nach unten, und mit einemmal, fast explosionsartig, knallt einem eine grelle Sonne ins Gesicht, und man ist in den Tropen, in einer balinesischen Landschaft mit Palmen, einer Welt von zauberhafter Schönheit, die in ein Tal mit Bananenplantagen, Äckern, einem Fischereihafen und armen Leuten mündet, die sich ihr Brot aus dem Boden und dem Meer kratzen müssen, dabei beobachtet von einem Stamm deutscher Hippies, die, wie die japanischen Soldaten im Urwald von Borneo, noch immer nicht gehört haben, daß der Krieg vorbei ist, und hier in der Volendammer Tracht einer sinnentleerten Denkweise herumlungern.
Am letzten Tag meines Aufenthalts komme ich an
Weitere Kostenlose Bücher