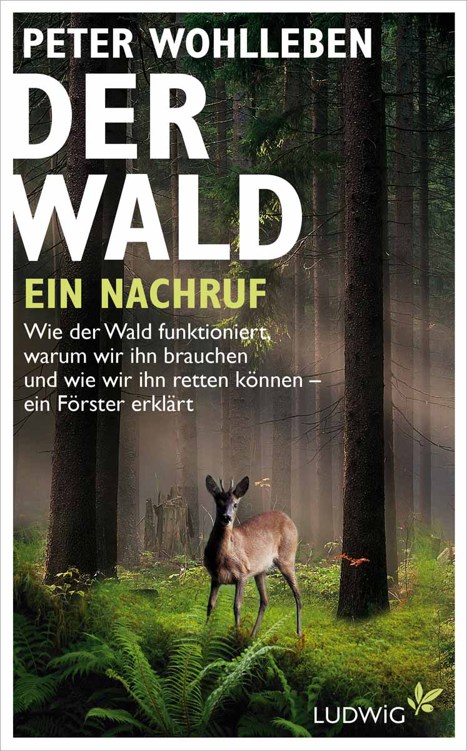![Der Wald - ein Nachruf]()
Der Wald - ein Nachruf
erfasst die Baumarten, das Alter der Waldbestände, Schäden am Boden, Wildfraß sowie die Qualitäten der Stämme. Dabei gibt es zwei Verfahren: die Kontrollstichprobe und die Schätzung. Bei der Kontrollstichprobe werden im 200-mal-200-Meter-Raster Metallbolzen im Erdreich versenkt, um die in einem Radius von zwölf Metern alle Daten ermittelt werden. Die Aufnahmepunkte kennt der Förster nicht; er kann dort also nicht gezielt besser wirtschaften und damit die Erhebung verfälschen. Hat man genügend Punkte ausgewertet, mindestens 150 Stück, so lässt sich sehr genau auf die Verhältnisse im gesamten Waldbesitz schließen. Wird diese Aufnahme nach zehn Jahren wiederholt, so kann eine präzise Aussage über die Nachhaltigkeit der Wirtschaftsweise getroffen werden. Aufgrund der Metallbolzen, die sich mithilfe eines Detektors auch nach langer Zeit wiederfinden lassen, kann die Inventur exakt an denselben Stellen wie beim ersten Durchgang erfolgen. Und so lässt sich ganz genau sehen, was im Wald in der letzten Dekade passiert ist. Wurde gut gearbeitet, ist der Wald wertvoller geworden oder wurde er geplündert? Kein Wunder, dass viele Kollegen die Kontrollstichprobe scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Denn wer lässt sich schon gern so genau in die Karten schauen. Jede Schlamperei, jede Rücksichtslosigkeit würde aufgedeckt werden. In Wäldern, die von staatlichen Beamten bewirtschaftet werden, wird daher vielfach auf die Schätzung gesetzt. Dabei wird der Wald nur sehr grob beurteilt, viele wichtige Parameter werden erst gar nicht erfasst. Exakte Aufnahme an Stichprobenpunkten? Überflüssig! Zerfahrene Bestände, beschädigte Bäume, zu starke Nutzung? Das fällt bei einem flüchtigen Waldbegang des Gutachters kaum auf. Diese Schätzmethode gilt offiziell als ebenbürtig zur aufwendigen Kontrollstichprobe, genügt damit den gesetzlichen Vorgaben und wird daher vehement von vielen Verwaltungen verteidigt. Selbst in meinem eigenen Revier, wo ich die Waldbesitzer von einer gründlichen Aufnahme überzeugen konnte, riet der zuständige Forstamtsleiter ab. Fürchtete er einen Präzedenzfall, der auf seinen Zuständigkeitsbereich abfärben könnte? Das hat es leider nicht getan, die grobe Schätzung ist bis heute in den meisten Wäldern das Mittel der Wahl. Und so findet der Raubbau an unserer Natur weitgehend unbeachtet statt.
Die Konsequenz des Sparens
Forstverwaltungen sind teuer, was jahrzehntelang jedoch keine Rolle spielte, da die Bevölkerung das Märchen, ein Wald müsse gepflegt werden, um ihn zu erhalten, glaubte. Zeitweise kostete diese »Pflege« den Steuerzahler über 10 000 Euro pro Jahr und Quadratkilometer. Denn was nichts kostet, taugt auch nichts. Und nach diesem Motto wurde gepflanzt, gepflegt und gekehrt – die Arbeiten glichen eher denen in einem Park als in einem Wald.
Wenn Kosten kaum eine Rolle spielen, schleicht sich schnell der Schlendrian ein. Im Wald ist das ganz besonders einfach, denn die Arbeit eines Försters lässt sich kaum kontrollieren. Jedes Revier ist ein Unikat. In einem gibt es viele junge Bäume und damit wenig erntefähiges Holz. Ein anderes hat zwar dicke Stämme, liegt aber in den Steillagen der Gebirge. Ein Vergleich ist so nicht möglich. Aus diesem Grund wurde auch vor wenigen Jahren der furchtbar komplizierte Akkordtarif für Waldarbeiter im öffentlichen Dienst abgeschafft. So blieb ein scheunengroßes Schlupfloch für Drückeberger.
Wie so ein Försterleben aussehen kann, verriet mir ein älterer Kollege anlässlich meiner Reviereinführung 1991: »Du gehst um 8:00 Uhr die Treppe herunter aus dem Schlafzimmer in dein Büro, setzt dich an den Schreibtisch und rasierst dich dort – und schon bist du im Dienst. Gegen 12:00 Uhr wird eingepackt und ab geht’s zum Essen ins nächste Restaurant.« Auf meine Frage, wie er sich denn den Nachmittag vertreibe, entgegnete er: »Der ist für den Sport reserviert.« Revierleiter, ein Halbtagsjob? Das passte nicht mit meinem damaligen Enthusiasmus zusammen, aber der Mann hatte recht. Nach vier Stunden war im Durchschnitt alles erledigt und ich konnte Däumchen drehen. Im Winter wurde es sogar noch ruhiger. Schon bei der ersten Schneeflocke riefen die Förster beim Forstamt an, um nachzufragen, ob die Waldarbeiter denn überhaupt arbeiten sollten. Es läge schließlich Schnee und die Tätigkeit im Wald sei unzumutbar. Damals spielten die Arbeitsämter noch mit und zahlten für zwei oder drei Monate Arbeitslosengeld, welches
Weitere Kostenlose Bücher