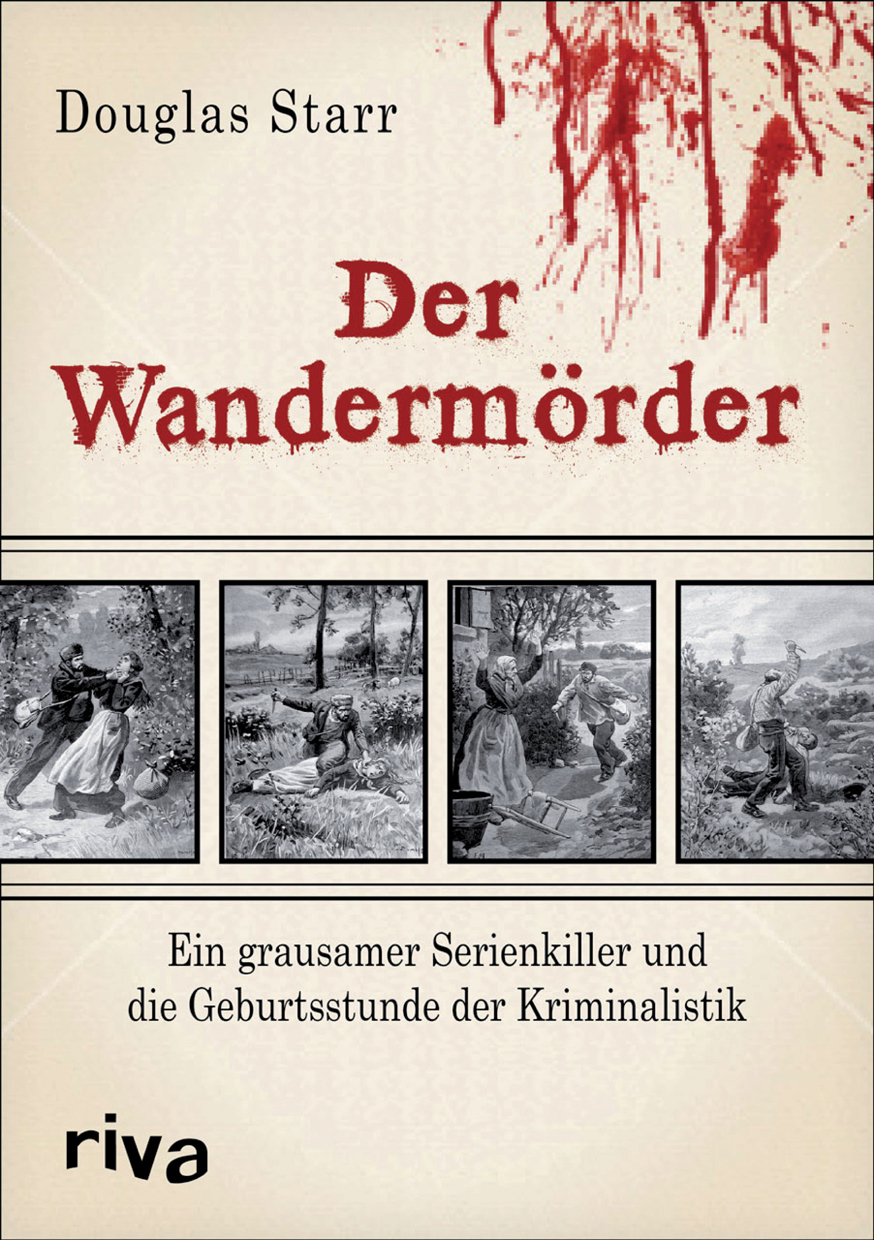![Der Wandermoerder]()
Der Wandermoerder
Drohungen aus. Lacassagne bemerkte aber auch grundlegende Ungereimtheiten in Vachers Geschichte. Einerseits wurde er von einem tollwütigen Hund gebissen und in den Nervenheilanstalten misshandelt, doch anderereseits agierte er unter »göttlicher Führung«. Vachers Erzählung war sowohl »hypochondrisch als auch größenwahnsinnig«. Diese Kombination von Symptomen war den Psychologen bisher noch nicht untergekommen, darum bezweifelte Lacassagne auch, dass sie wirklich echt waren. Sie standen »keinesfalls im Einklang mit seiner Diagnose in Dole«.
Was Lacassagne und seinen Kollegen am meisten auffiel, war, wie zielgerichtet Vacher an seinem Fall arbeitete. Als Vacher im Gefängnis in Belley eintraf, untersuchte ihn der Anstaltsarzt Bozonet flüchtig und kam zu dem Schluss, dass die Schuldfähigkeit des Häftlings »erheblich eingeschränkt« sei. Einige Wochen später kam Dr. Léon Madeuf, ein Gegner der Todesstrafe, unangekündigt aus Paris, um mit Vacher zu sprechen. Fourquet hatte ihm das verboten, doch als Fourquet einmal für kurze Zeit verreist war, behauptete Madeuf, die Erlaubnis des Richters zu besitzen, sodass Bozonet ihn einließ. Madeuf schrieb zwar nie einen Bericht, aber es war klar, auf wessen Seite er stand. Vacher, der einen Verbündeten witterte, schrieb später an Madeuf, dass es »absolut notwendig« sei, mithilfe der Presse seine Situation publik zu machen. Wenn Madeuf die Lyoner Zeitungen dazu bringen könne, seinen Brief zu veröffentlichen, sei »der größte Teil [unserer Sache] geschafft«. Jetzt, in Lyon, schrieb Vacher der Justizbehörde, dass Madeuf etwas Klarheit in den Fall bringen könne.
Lacassagne und seine Kollegen hatten nie zuvor jemanden so systematisch daran arbeiten sehen, in eine Heilanstalt geschickt zu werden. Das war »sein einziges Ziel«, schrieb Lacassagne. »Er hat nicht vergessen, wie leicht es war, entlassen zu werden.« Vacher wusste natürlich um diese Bedenken und lieferte den Ärzten daher ein Gegenargument: »Warum wurde ich noch nicht in eine Heilanstalt eingewiesen? Ich werde es Ihnen sagen: Weil Sie befürchten, dass ich fliehe. Fliehen … warum? Ich bin inzwischen so bekannt, dass man mich sofort wieder einfangen würde, falls ich je entkommen könnte. Nein, nein, ich würde nicht zu fliehen versuchen.«
Im Gegensatz zu vielen anderen Gefangenen in Saint-Paul bewunderte Vacher Lacassagne niemals – vielleicht weil er dessen Skepsis spürte. Sobald Vacher erkannt hatte, dass Lacassagne nicht auf seiner Seite stand, beschloss er, ihm gar nichts mehr zu sagen. Es gab niemals, nicht einmal zeitweilig, einen vertrauensvollen Austausch wie mit Fourquet. Die täglichen Gespräche führten nicht zu einer Katharsis oder zu einem Geständnis, sie waren lediglich ein pausenloser Schlagabtausch zwischen zwei Männern mit unbeugsamem Willen. Vacher schien sich jedoch über die Herausforderung zu freuen und betrachtete ihr Zusammensein als Spiel. »Wissen Sie, Herr Doktor«, sagte er eines Morgens arrogant, »der schwierigste Teil Ihrer Aufgabe besteht darin, meinen Geisteszustand zu ermitteln.«
Einmal glaubte Lacassagne schon, endlich einen Zugang gefunden zu haben. Er fragte Vacher nach einem Mord, dessen er verdächtig war, den er jedoch nicht gestanden hatte. Jedes Mal, wenn der Professor diesen Punkt bisher angesprochen hatte, war Vacher in verdrießliches Schweigen versunken. Doch diesmal schien er zuzuhören, neigte aufmerksam den Kopf und verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Lacassagne hoffte, dass der Gefangene ihm endlich etwas zu diesem Thema sagen werde, doch dann zuckte Vacher plötzlich melodramatisch mit den Schultern, begann hin und her zu gehen und rief: »Ich will Ihnen mal etwas sagen – ich habe wirklich genug von Ihnen. Ich werde nur noch sagen, was ich will, und kein Wort mehr. Ich habe genug gesagt. Lesen Sie die Gespräche mit dem Richter nach. Es ist vorbei. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.« Dann schwieg er erneut.
Um Vachers Abwehrhaltung zu durchbrechen, begann Lacassagne daraufhin ein Gespräch über Vachers altes Regiment. Doch das brachte ihm nur eine Zurechtweisung durch den Gefangenen ein.
Sie sind schuld daran, dass Sie mir nicht vertrauen. Erinnern Sie sich an den Tag, als Sie es wagten und beinahe meinen Selbstrespekt und meinen Patriotismus beleidigt hätten, indem Sie von den kleinen und großen Siegen meiner Kameraden während meines Dienstes in der Armee sprachen? Sie hatten recht, mich um meine Meinung zu
Weitere Kostenlose Bücher