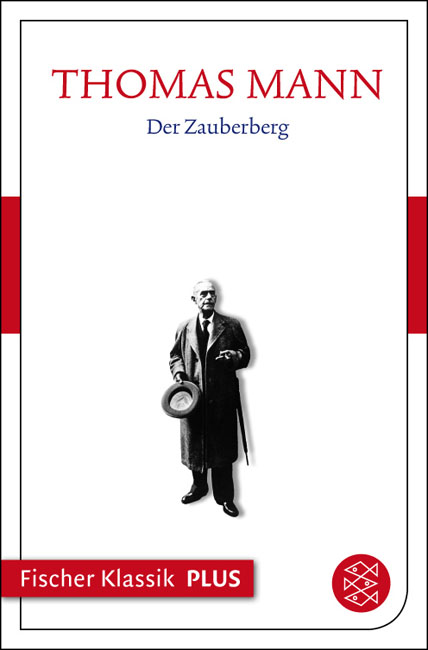![Der Zauberberg]()
Der Zauberberg
gebracht, daß Frau Chauchat im Profil nicht günstig aussah, etwas scharf, nicht mehr ganz jung. Die Folge? Er vermied es, sie im Profil zu betrachten, schloß buchstäblich die Augen, wenn sie ihm zufällig von fern oder nah diese Ansicht bot, es tat ihm weh. Warum? Seine Vernunft hätte freudig die Gelegenheit wahrnehmen sollen, sich zur Geltung zu bringen! Aber was verlangt man … Er wurde blaß vor Entzücken, als Clawdia in diesen glänzenden Tagen zum zweiten Frühstück wieder einmal in der weißen Spitzenmatinee erschien, die sie bei warmem Wetter trug, und die sie so außerordentlich reizvoll machte, – verspätet und türschmetternd darin erschien und {346} lächelnd, die Arme leicht zu ungleicher Höhe erhoben, gegen den Saal Front machte, um sich zu präsentieren. Aber er war entzückt nicht sowohl dadurch, daß sie so günstig aussah, sondern
darüber
, daß es so war, weil das den süßen Nebel in seinem Kopf verstärkte, den Rausch, der sich selber wollte, und dem es darum zu tun war, gerechtfertigt und genährt zu werden.
Ein Gutachter von der Denkungsart Lodovico Settembrinis hätte angesichts eines solchen Mangels an gutem Willen geradezu von Liederlichkeit, von »einer Form der Liederlichkeit« sprechen mögen. Hans Castorp gedachte zuweilen der schriftstellerischen Dinge, die jener über »Krankheit und Verzweiflung« geäußert, und die er unbegreiflich gefunden oder so zu finden sich den Anschein gegeben hatte. Er sah Clawdia Chauchat an, die Schlaffheit ihres Rückens, die vorgeschobene Haltung ihres Kopfes; er sah sie beständig mit großer Verspätung zu Tisch kommen, ohne Grund und Entschuldigung, einzig aus Mangel an Ordnung und gesitteter Energie; sah sie aus eben diesem grundlegenden Mangel jede Tür hinter sich zufallen lassen, durch die sie aus oder ein ging, Brotkugeln drehen und gelegentlich an den seitlichen Fingerspitzen kauen, – und eine wortlose Ahnung stieg in ihm auf, daß, wenn sie krank war, und das war sie wohl, fast hoffnungslos krank, da sie ja schon so lange und oft hier oben hatte leben müssen, – ihre Krankheit, wenn nicht gänzlich, so doch zu einem guten Teile moralischer Natur, und zwar wirklich, wie Settembrini gesagt hatte, nicht Ursache oder Folge ihrer »Lässigkeit«, sondern mit ihr ein und dasselbe war. Er erinnerte sich auch der wegwerfenden Gebärde, womit der Humanist von den »Parthern und Skythen« gesprochen hatte, mit denen er Liegekur halten müsse, einer Gebärde natürlicher und unmittelbarer, nicht erst zu begründender Geringschätzung und Ablehnung, auf die Hans Castorp sich von früher her wohl verstand, – von damals her, als er, der {347} sich bei Tische sehr gerade hielt, das Türenwerfen aus Herzensgrund haßte und nicht einmal in Versuchung kam, an den Fingern zu kauen (schon darum nicht, weil ihm statt dessen Maria Mancini gegeben war), an den Ungezogenheiten Frau Chauchats schweren Anstoß genommen und sich eines Gefühls der Überlegenheit nicht hatte entschlagen können, als er die schmaläugige Fremde in seiner Muttersprache sich hatte versuchen hören.
Solcher Empfindungen hatte Hans Castorp sich nun, auf Grund der inneren Sachlage, fast ganz begeben, und der Italiener war es viel mehr, an dem er sich ärgerte, weil dieser in seinem Dünkel von »Parthern und Skythen« gesprochen, – während er doch nicht einmal Personen vom »Schlechten« Russentisch im Auge gehabt hatte, demjenigen, an dem die Studenten mit dem allzu dicken Haar und der unsichtbaren Wäsche saßen und unaufhörlich in ihrer wildfremden Sprache disputierten, außer der sie sich offenbar in keiner auszudrükken wußten, und deren knochenloser Charakter an einen Thorax ohne Rippen erinnerte, wie Hofrat Behrens es neulich beschrieben hatte. Es war richtig, daß die Sitten dieser Leute einem Humanisten wohl lebhafte Abstandsgefühle erregen konnten. Sie aßen mit dem Messer und besudelten auf nicht wiederzugebende Weise die Toilette. Settembrini behauptete, daß einer von ihrer Gesellschaft, ein Mediziner in höheren Semestern, sich des Lateinischen vollkommen unkundig erwiesen, beispielsweise nicht gewußt habe, was ein vacuum sei, und nach Hans Castorps eigenen täglichen Erfahrungen log Frau Stöhr wahrscheinlich nicht, wenn sie bei Tische erzählte, das Ehepaar auf Nr. 32 empfange den Bademeister morgens, wenn er zur Abreibung komme, zusammen im Bette liegend.
Mochte dies alles zutreffen, so bestand doch die augenfällige Scheidung von »gut« und
Weitere Kostenlose Bücher