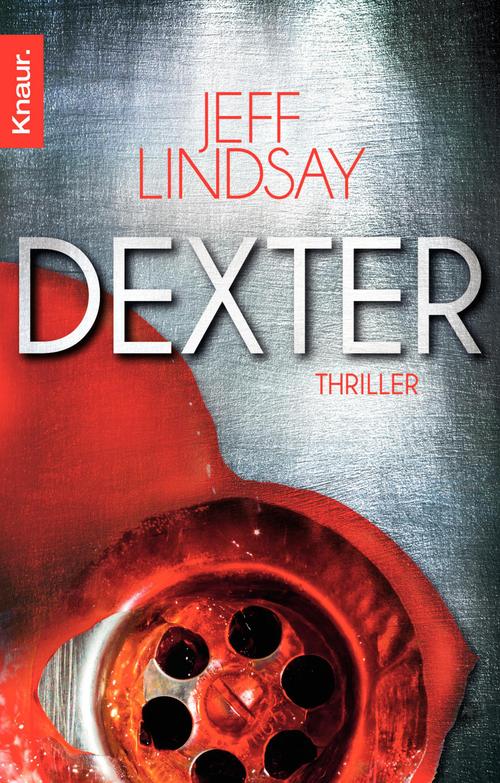![Dexter]()
Dexter
offenbar eine junge Frau. Sie hielt den Kopf gesenkt und regte sich nicht, aber als ich sie musterte, hob sie ihn langsam, als wäre sie erschöpft oder von Drogen betäubt, und erwiderte meinen Blick.
Es war Samantha Aldovar.
Ohne nachzudenken, packte ich den Türgriff und zog. Sie war nicht verschlossen, aber mir war klar, dass man sie nicht von innen öffnen konnte. »Samantha«, rief ich. »Geht es dir gut?«
Sie lächelte mich müde an. »Ganz toll«, antwortete sie. »Ist es jetzt so weit?«
Ich hatte keine Ahnung, was sie damit meinte, deshalb schüttelte ich einfach den Kopf. »Ich bin hier, um dich zu retten. Ich will dich zu deinen Eltern nach Hause bringen.«
»Warum?«, fragte sie, und ich nahm an, dass sie tatsächlich unter Drogen stand. Es war einleuchtend; Drogen würden sie ruhigstellen und den Aufwand, sie zu bewachen, minimieren. Was jedoch bedeutete, dass ich sie würde tragen müssen.
»In Ordnung«, sagte ich. »Nur eine Sekunde.« Ich sah mich nach etwas um, mit dem ich die Tür feststellen konnte, und entschied mich für einen Zwanziglitertopf, der an dem Gestell über dem Herd hing. Ich klemmte ihn zwischen Kühlkammertür und Rahmen und ging hinein.
Ich hatte erst zwei Schritte getan, als mir klarwurde, was die Behälter in den Regalen enthielten.
Blut.
Riesige Behälter in großer Anzahl, gefüllt mit Litern von Blut. Ich starrte das Blut an, es starrte zurück, und ich konnte mich nicht mehr rühren. Doch dann holte ich tief Luft, stieß sie wieder aus, und die Wirklichkeit hatte mich wieder. Es war nur eine Flüssigkeit, wohlverwahrt hinter verschlossenen Türen, so dass sie niemandem weh tun konnte, und das Wichtigste war, Samantha zu holen und von hier zu verschwinden. Ich trat die letzten Schritte bis zum Klappbett und sah zu ihr hinunter.
»Komm! Es geht nach Hause.«
»Ich will nicht.«
»Ich weiß«, sagte ich beruhigend, da ich dachte, ein typisches Beispiel für das Stockholm-Syndrom vor mir zu haben. »Gehen wir.« Ich legte meinen Arm um sie und zog sie von der Liege, und sie wehrte sich nicht. Ich schlang ihren Arm um meine Schulter und führte sie zur Tür und zur Freiheit.
»Wart mal«, murmelte sie. Sie sprach ein wenig verschwommen. »Ich brauch meine Tasche. Auf dem Bett.« Sie wies mit dem Kopf zu der Liege, zog ihren Arm weg und hielt sich am Regal fest.
»Okay«, sagte ich, drehte mich zu der Liege um und sah nach unten. Ich entdeckte keine Tasche – hörte jedoch ein Scheppern, und als ich mich umdrehte, musste ich feststellen, dass Samantha den Zwanziglitertopf beiseitegetreten hatte – und langsam die Kühlraumtür zuzog.
»Halt!«, sagte ich, wobei ich mir noch blöder vorkam, als sich das anhört. Samantha sah das offensichtlich genauso, denn sie hielt keineswegs inne, und ehe ich sie erreichen konnte, hatte sie die Tür zugeschlagen und drehte sich mit einem Ausdruck leicht glasigen Triumphs im Gesicht zu mir um.
»Hab ich dir doch gesagt«, nuschelte sie. »Ich will nicht nach Hause.«
[home]
27
I n der Kühlkammer war es kalt. Das mag banal klingen, aber Banalität wärmt nicht, und seit der Schock über Samanthas Verrat nachgelassen hatte, zitterte ich vor mich hin. Es war kalt, die kleine Kammer voller Behälter mit Blut, und ich sah keine Möglichkeit zur Flucht, nicht einmal mit Hilfe meiner Brechstange. Ich hatte versucht, die kleine Scheibe in der Kühlkammertür einzuschlagen, was beweist, wie sehr mich die Panik im Würgegriff hielt. Die Scheibe war mehr als zwei Zentimeter dick und mit Draht verstärkt, und selbst wenn es mir gelungen wäre, hätte ich nicht einmal das Bein hindurchschieben können.
Selbstverständlich hatte ich versucht, Deborah per Handy zu erreichen, doch ebenso selbstverständlich hatte ich in der isolierten Kammer mit den massiven Stahlwänden kein Netz. Ich wusste, dass sie massiv waren, weil ich nach meinen vergeblichen Versuchen, die Scheibe einzuschlagen und die Tür mit der Brechstange aufzustemmen – wobei sie sich verbog –, ein paar Minuten gegen die Wände gehämmert hatte, was in etwa so effektiv war, als hätte ich in derselben Zeit Daumen gedreht. Die Brechstange krümmte sich ein wenig mehr, die endlosen Reihen Blut schienen immer näher zu rücken, ich begann allmählich zu keuchen – und Samantha saß einfach da und lächelte.
Zum Thema Samantha – warum saß sie mit diesem Mona-Lisa-Lächeln da, ein Bild der Zufriedenheit? Sie musste doch wissen, dass sie sich in nicht allzu ferner
Weitere Kostenlose Bücher