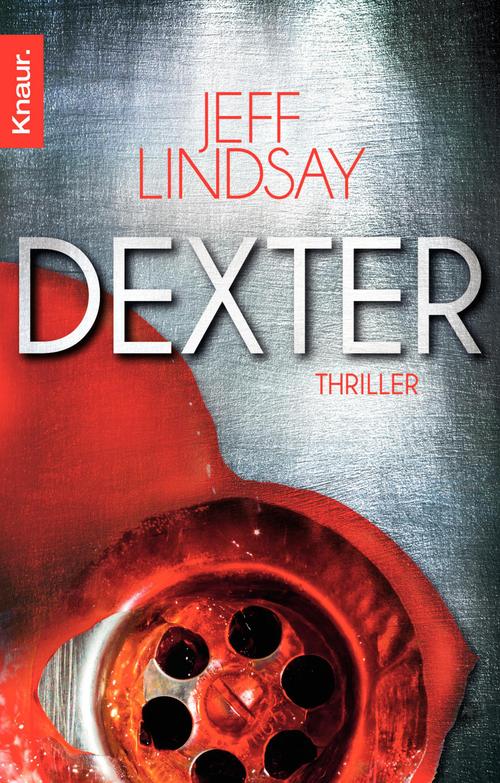![Dexter]()
Dexter
stand dort, von edler Bereitschaft erfüllt, meinem endgültigen Schicksal mit wahrem Mut und männlicher Entschlossenheit entgegenzutreten – und wieder versetzte mir das Leben einen Klaps.
»Tja«, sagte die Kapuzengestalt. »Sieht so aus, als müsste ich mal wieder die Kastanien aus dem Feuer holen.«
Und als er die Waffe hob, dachte ich:
Ich kenne diese Stimme.
Ich kannte sie, und ich wusste nicht, ob ich jubeln, weinen oder mich erbrechen sollte. Ehe ich eins davon tun konnte, drehte er sich um und feuerte auf Alana, die langsam und unter Schmerzen auf ihn zugekrochen war, eine dicke Blutspur hinter sich herziehend. Aus dieser kurzen Entfernung schleuderte der Schuss sie hoch und riss sie beinah in zwei Hälften, ehe die beiden eleganten Stücke in einem erbärmlich unordentlichen Haufen zu Boden stürzten.
»Elende Schlampe«, kommentierte er, während er die Waffe senkte, die Kapuze zurückschlug und die Maske abnahm. »Aber die Bezahlung war ausgezeichnet, und die Arbeit hat mir gefallen – ich kann sehr gut mit Messern umgehen.«
Ich hatte recht. Ich kannte diese Stimme.
»Ehrlich, man sollte meinen, du hättest darauf kommen müssen«, sagte mein Bruder Brian. »Ich habe dir genug Hinweise gegeben – der schwarze Chip in dem Beutel zum Beispiel.«
»Brian«, sagte ich, und obgleich es eins der dümmsten Dinge war, die ich jemals geäußert hatte, konnte ich nicht an mich halten. »Du bist hier.«
»Natürlich bin ich hier«, antwortete er mit diesem schrecklichen künstlichen Lächeln, das irgendwie nicht ganz so falsch wirkte wie sonst. »Wozu hat man denn Familie?«
Ich überdachte die letzten Tage: Deborah, die mich aus dem Trailer in den Everglades gerettet hatte, und jetzt dies, und ich schüttelte den Kopf. »Anscheinend ist Familie dafür da, um vor Kannibalen gerettet zu werden.«
»Tja dann«, meinte Brian. »Hier bin ich.«
Und dieses eine Mal wirkte sein schreckliches künstliches Lächeln außerordentlich real und herzlich.
[home]
40
W ie jedes klischeeliebende menschliche Wesen weiß, schütten nur die Wolken ihre Ladung über uns aus, in denen irgendwo ein Silberstreif verborgen ist. In diesem Fall lag der kleine Vorteil der Gefangenschaft bei Kannibalen darin, dass überall Messer herumlagen, weshalb Brian meine Fesseln sehr rasch entfernen konnte. Beim zweiten Mal tat das Abreißen des Paketbands gar nicht mehr so weh, da von meinen Haaren nicht mehr viel übrig war, das man mit der Wurzel hätte ausreißen können, aber besonders erfreulich war es trotzdem nicht, weshalb ich mir einen Augenblick Zeit nahm, um meine Handgelenke zu reiben. Offensichtlich einen Augenblick zu lang.
»Vielleicht könntest du dich später massieren, Bruderherz«, mahnte Brian. »Wir müssen los.« Er wies mit dem Kopf zum Fallreep.
»Ich muss Deborah holen.«
Er seufzte theatralisch. »Was ist das nur mit dir und diesem Mädchen?«
»Sie ist meine Schwester.«
Brian schüttelte den Kopf. »Ich weiß. Aber beeil dich, ja? Hier wimmelt es von diesen Typen, und meiner Meinung nach sollten wir ihnen lieber aus dem Weg gehen.«
Auf dem Weg zur Kabine mussten wir am Hauptmast vorbei, und trotz Brians Drängen blieb ich bei Samantha stehen, wobei ich sorgsam darauf bedacht war, nicht in die Blutlache zu treten, die sich rechts von ihr ausbreitete.
Ich musterte sie gründlich. Ihr Gesicht war unglaublich blass, und da sie nicht mehr stöhnte und ächzte, war ich einen Moment lang überzeugt, sie wäre bereits tot. Ich legte die Hand an ihren Hals und fühlte nach dem Puls; er war noch vorhanden, aber nur sehr schwach, und unter meiner Berührung zuckten ihre Lider nach oben. Ihr Blick war verschwommen, und sie erkannte mich offensichtlich nicht. Dann senkten sich ihre Lider wieder, und sie sagte etwas, das ich nicht verstehen konnte, weshalb ich mich vorbeugte.
»Was hast du gesagt?«, fragte ich.
»War ich … gut?«, wisperte sie heiser. Es dauerte einen Moment, aber schließlich verstand ich, was sie meinte.
Man lehrt uns, es sei wichtig, die Wahrheit zu sagen, aber meiner Erfahrung nach liegt das wahre Glück darin, Menschen zu sagen, was sie hören wollen, was gemeinhin nicht dasselbe ist. Und falls man sich hinterher korrigieren muss, ist das auch nicht schlimm. Für Samantha würde es kein Hinterher mehr geben, und angesichts dessen schwand mein Groll, und ich wollte nicht gemein sein.
Deshalb beugte ich mich zu ihrem Ohr und erzählte ihr, was sie hören wollte.
»Du warst
Weitere Kostenlose Bücher