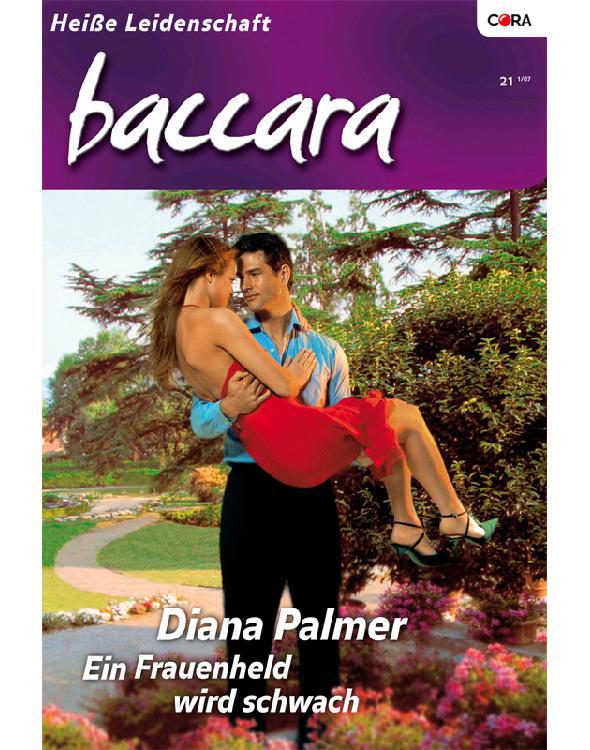![Diana Palmer]()
Diana Palmer
Marge recht hatte. Trotzdem konnte er es sich nicht vorstellen, Tellie einfach so gehen zu lassen, ohne sich vorher mit ihr ausgesprochen zu haben. Auf seinem Gesicht spiegelte sich der Widerstreit, in dem er mit sich selbst stand. Er sah Marge in die Augen. „Nein, Marge, so geht es nicht. Ich möchte wenigstens den Versuch machen, ein paar Dinge mit ihr zu klären, bevor sie abreist.“
„Zum Beispiel?“
„Ach, eine Menge. Ich habe ihr die ganze letzte Zeit nur Kummer bereitet. Ich möchte sie auch einmal froh machen.“
„Das kannst du nur, wenn du es ernst mit ihr meinst. Wenn du eine kurze Affäre mit ihr hast, zerstörst du sie.“
„Das weiß ich auch“, gab er unwillig zu. Es war ihm ja auch ernst mit Tellie. Sie lag ihm am Herzen. Aber was Marge angesprochen hatte, war eine feste Bindung, und davor hatte er Angst. „Vielleicht hast du wirklich recht, Marge, und man muss Tellie mehr Zeit lassen“, sagte er dann versöhnlicher.
„Tellie ist ein so wunderbarer Mensch“, fuhr Marge fort. „Der Mann, der sie einmal bekommt, ist jetzt schon zu beneiden. Und sie wird einmal eine wunderbare Mutter für ihre Kinder sein.“
Das war brutal. Die Vorstellung von Tellie mit einem anderen Mann und mit einem Kind war für J.B. wie ein Stich ins Herz. Er hatte nie in Erwägung gezogen, dass Tellie einmal einem anderen gehören könnte. Irgendwie hatte er immer wie selbstverständlich angenommen, dass sie ihm gehörte, obwohl er ihr Grund genug gegeben hatte, ihn zu hassen.
„Hör zu, Marge, ich bin in den letzten beiden Tagen in mich gegangen und habe über mich selbst nachgedacht. Was ich dabei herausgefunden habe, hat mir nicht gefallen. Ich habe so getan, als berechtige mich mein Schicksal dazu, nur an mich selbst zu denken. Das war so eine Art Selbstschutzmechanismus. Am meisten hatte Tellie darunter zu leiden. Das wollte ich nicht.“
„Du hast es aber getan. Und es grenzte schon an Grausamkeit.“
J.B. sah wieder das Bild vor sich, wie Tellie nach ihrem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde und auf der Trage lag. Wie wenig hatte daran gefehlt, dass er auch sie verloren hätte. Es war ein unerträglicher Gedanke, bei dem J.B. fast übel wurde. Wenn er gekonnt hätte, hätte er das, was er Tellie angetan hatte, ungeschehen gemacht. Aber auf jeden Fall musste er einen Weg finden, um sie davon zu überzeugen, dass für sie beide noch nicht alles verloren war.
J.B. holte tiefe Luft. „Sag Tellie bitte, dass es mir sehr leidtut. Sie wird mir zwar nicht glauben, aber sag es ihr trotzdem.“
„Dass dir was leidtut?“, fragte Marge nach und schaute ihm ins Gesicht.
„Alles.“
Der letzte Tag bei Ballengers war hart für Tellie. Es gab viel zu tun an diesem brütend heißen Freitag. Immer mehr finstere Wolken türmten sich am Horizont auf und kündigten Unwetter an. Die US-Flagge vor dem Firmengebäude knatterte im Wind, als Tellie zur Mittagspause nach Hause fuhr, um mit Marge und den Mädchen zu essen.
Es wehte immer stärker, und Tellie musste kräftig gegensteuern, um den kleinen Wagen auf der Straße zu halten. Regen hatte noch nicht eingesetzt, aber der Himmel sah schon aus, als wollte er jeden Augenblick seine Schleusen öffnen. Aus dem Autoradio erfuhr Tellie, dass es tatsächlich eine Tornado-Warnung für die Umgebung von Jacobsville gab. Die Vorhersage rechnete damit am späten Nachmittag.
Da an diesem Tag schulfrei war, waren auch Brandi und Dawn zum Mittagessen da. Tellie beeilte sich, um rechtzeitig wieder an ihrem Arbeitsplatz zu sein. Aber als sie aus dem Haus treten wollte, heulte draußen schon der Sturm.
„Du machst keinen Schritt vor die Tür“, entschied Marge resolut.
Nell wies zum Himmel. Dort türmten sich dunkle Wolken zu bizarren Gebilden auf, von denen ein neongrünes Licht auszugehen schien. Mit jeder Minute schien der Sturm stärker zu werden. Aus der Ferne hörte man Donnergrollen, das aber plötzlich von Sirenengeheul aus der Stadt übertönt wurde.
„Ist das Feueralarm?“, fragte Dawn.
„Nein“, antwortete Nell bestimmt. „Das ist die Sirene auf dem Gerichtsgebäude. Das ist Tornado-Alarm. Das heißt, für uns wird es Zeit, in den Keller zu gehen.“
Sie verließen die vordere Veranda, von wo aus sie das Spektakel betrachtet hatten, und begaben sich in den Schutzraum, wie ihn fast jedes Haus hier in der Umgebung hatte. Wände und Decken waren mit Stahlträgern verstärkt, in den Regalen befand sich ein Vorrat von Lebensmitteln und Trinkwasser, und
Weitere Kostenlose Bücher