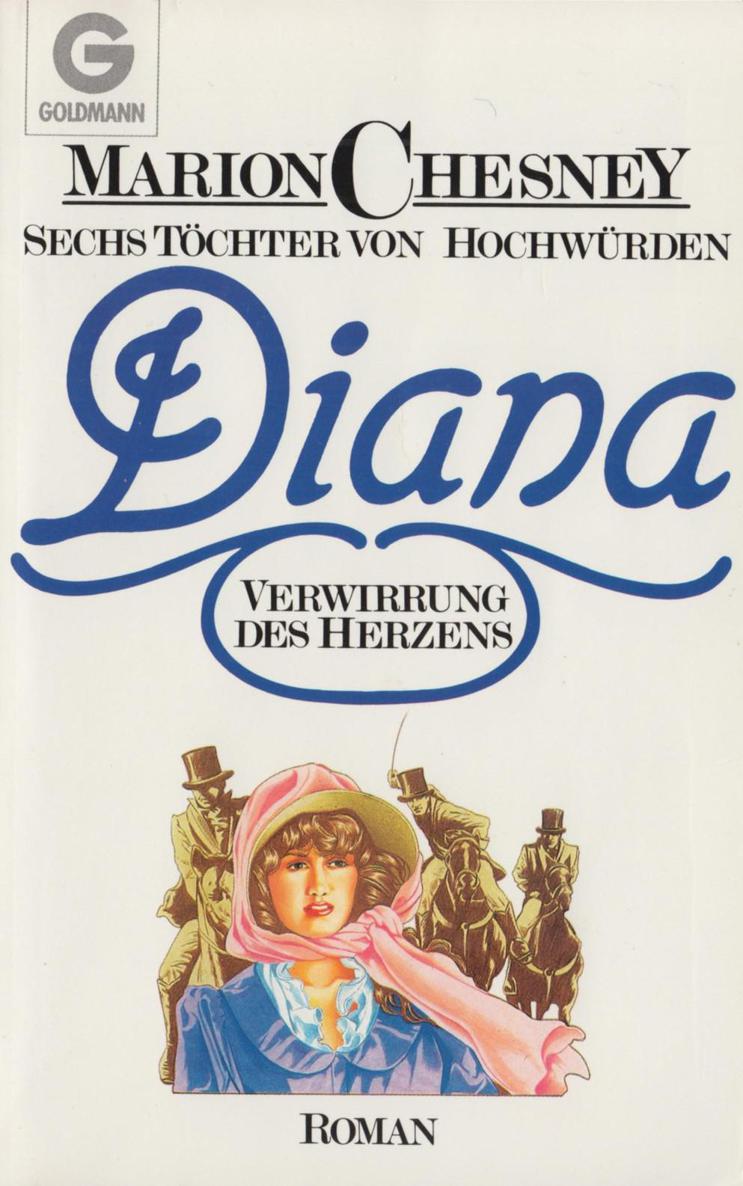![Diana - sTdH 5]()
Diana - sTdH 5
hatte.
»Diana!« rief sie aus. »Warum
bist du so angezogen?«
»O Freddie«, seufzte Diana, »ich habe unsere Familie in eine
schlimme Lage gebracht. Ich weiß nicht aus noch ein.«
»Erzähl«, drängte
Frederica, »und ich will sehen, was ich tun kann.«
»Ich weiß
nicht, ob ich es schaffe, dir alles in zehn Minuten zu erzählen«, sagte Diana,
»aber ich will es versuchen.« Sie begann ihrer erstaunten Schwester alles zu
berichten, was geschehen war.
Als sie
geendet hatte, schlug Frederica die Hände zusammen und sagte: »Sag mir bloß,
wie ich dir helfen kann.«
»Es gibt
nichts, was du tun könntest, Freddie«, seufzte Diana. »Ich bin gekommen, um
mich zu verabschieden. Ich glaube, ich gehe nach London zu Lady Godolphin und
bitte sie, mir zu helfen, eine Arbeit zu finden. Sie wird nicht schockiert
sein, weißt du. Es hat keinen Sinn, zu Minerva oder Annabelle oder einer von
den anderen zu gehen. Sie würden es nur Vater berichten, und dann müßte ich
nach Hopeworth zurück. Aber ich könnte es nicht ertragen, jemandem
nach diesem Skandal ins Auge zu sehen.«
»Aber ich
habe das Gefühl, du liebst diesen Lord Dantrey«, sagte Frederica.
»Das spielt
keine Rolle. Eines ist ganz klar, Freddie, nämlich, daß er mich nicht liebt.
Ach du meine Güte, ich höre diese Frau zurückkommen.«
»Schreib
mir wenigstens«, bettelte Frederica und hängte sich an ihren Ärmel.
Diana
umarmte ihre Schwester leidenschaftlich. »Ich schreibe bestimmt, Freddie«,
flüsterte sie.
Sie machte
vor der Schulleiterin, die hereinkam, eine Verbeugung und ging.
Frederica
rannte nach oben und blickte aus dem Fenster auf dem Treppenabsatz. Im Hof
unten saß Diana mit gesenctem Kopf auf ihrer Stute Blarney. Über ihr Gesicht
liefen Tränen, als sie schließlich den Kopf hob und im Galopp davonritt.
Frederica
wandte sich vom Fenster ab und starrte ihr Spiegelbild an. Ihr dunkles Haar
hing ihr in Strähnen unter der Haube hervor, ihre farblosen Augen blickten
nachdenclich. Sie hatte eine Diana vor Augen, die glücklich war, gesund, schön
und vor Lebenslust strotzend. Diana war dazu geboren, sich zu verlieben und für
alle Zeiten glücklich zu leben – ein beneidenswerter Zustand, den Frederica
nach ihrer eigenen Überzeugung nicht einmal anstreben konnte. Für sie war es
besser, daß ihre Liebhaber zwischen den Buchdeckeln blieben, wo sie nichts
aussetzen konnten an dieser einen Armitage, die die Erwartungen nicht erfüllte,
an dieser einen Tochter, die weder das Aussehen noch den Charme noch die Anmut
geerbt hatte. Sie seufzte ein bißchen und dachte an Diana, die jetzt so allein
und gefährdet in der Welt war.
»Es ist
einfach nicht fair«, murmelte sie nach einer Weile. »Es muß etwas geschehen, um
sie aufzuhalten.« Frederica setzte sich auf die Stufen und dachte scharf nach.
Dann rannte sie in die leere Schulbibliothek hinunter und nahm Papier und
Bleistift.
Sie holte
tief Atem, zog das Papier näher zu sich heran und begann zu schreiben. »Lieber
Lord Dantrey ...«
Zwei
Tage später wurde
Lady Godolphin durch ein leises Klopfen an der Tür geweckt. Sie ächzte und
fluchte. Warum hatte ausgerechnet an diesem Morgen einer ihrer sonst so
diskreten Diener beschlossen, sich schlecht zu benehmen?
»Grrmph«,
ertönte es schläfrig vom anderen Kissen.
»Schlaf
weiter, Arthur«, sagte Lady Godolphin zu Colonel Brian. »Es ist nur ein dummer
Diener.«
Lady
Godolphin rückte ihre scharlachrote Perücke zurecht und band die Bänder ihrer
Nachthaube fester unter dem Kinn, schwang sich aus dem Bett und watschelte zur
Tür.
Sie öffnete
die Tür einen Spalt und schaute Mice, ihren Butler, grimmig an.
»Wie kommen
Sie dazu, Sie Einfaltspinsel, mich im Morgengrauen zu wecken?« fragte sie.
»Es ist ein
Uhr mittags«, sagte Mice beleidigt.
»Es ist
Morgengrauen, Sie Tölpel.«
»Mr. David
Armitage wartet schon seit vier Stunden unten, Mylady. Er hat gesagt, ich soll
Sie nicht wecken. Aber der junge Mann scheint Kummer zu haben ...«
»O mein
Gott«, stöhnte Lady Godolphin. »Ist in Ordnung.«
»Worum ging
es denn?« murmelte Colonel Brian aus dem Bett.
»Laß gut
sein«, sagte Lady Godolphin mit gedämpfter Stimme, weil sie sich gerade ihren
Unterrock über den Kopf zog, ohne die Bänder aufzumachen. »Wir sind widerliche
Liebende, nicht wahr, Arthur?«
»Meine
Liebe, wie könnte ich je widerlich zu dir sein?«
»Nun, das sagt der Dichter –
›Ein Liebespaar, dem widerlich das Glück.‹«
»Widrig –
meine
Weitere Kostenlose Bücher