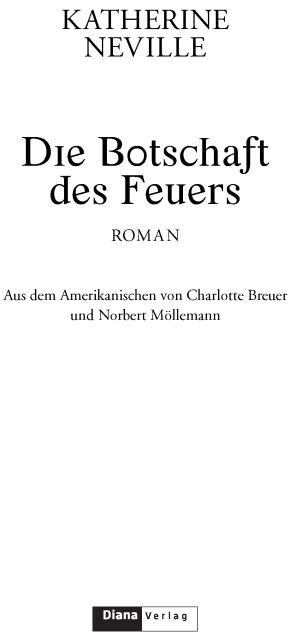![Die Botschaft des Feuers]()
Die Botschaft des Feuers
Shelley befallen hatte.
Er wurde ganz langsam umgebracht.
Byron begriff, dass es, wenn er nicht bald handelte und sein Wissen dem einen Menschen offenbarte, der es erfahren musste und dem er vertrauen konnte, schon bald zu spät sein könnte. Und dann wäre mit Sicherheit alles verloren.
Sein Kammerdiener Fletcher stand jetzt neben seinem Bett, in der Hand die Flasche mit dem verdünnten Brandy, Byrons einziger Labsal: Im Nachhinein betrachtet, war Fletcher von Anfang an der Klügere gewesen. Er hatte sich lange geweigert,
seinen Herrn nach Griechenland zu begleiten, und diesen angefleht, die Sache der griechischen Unabhängigkeit lieber finanziell zu unterstützen, als sich persönlich daran zu beteiligen. Schließlich waren beide bisher nur einmal in Messolongi gewesen, und zwar kurz nach ihrem Besuch bei Ali Pascha vor dreizehn Jahren.
Aber vor neun Tagen, als Byron an diesem rätselhaften, anscheinend unheilbaren Leiden »erkrankt« war, hatte der normalerweise stoische Fletcher beinahe die Fassung verloren. Die Dienstboten, die Militärangehörigen, die Ärzte, sie alle redeten in verschiedenen Sprachen.
»Wie beim Turmbau zu Babel!«, hatte Fletcher ausgerufen und sich verzweifelt die Haare gerauft. Es hatte Übersetzungsversuchen in drei verschiedenen Sprachen bedurft, für den Patienten eine Schüssel klare Brühe mit einem geschlagenen Ei zu organisieren.
Gott sei Dank war Fletcher jetzt hier - und sie waren ausnahmsweise einmal allein. Nun musste der vertraute Kammerdiener, ob es ihm gefiel oder nicht, zu einer letzten Pflicht gedrängt werden.
Byron berührte Fletchers Arm.
»Noch einen Brandy, Sir?«, fragte der Diener mit einer so feierlichen und gequälten Miene, dass Byron am liebsten laut aufgelacht hätte - wenn es ihn nicht so viel Kraft gekostet hätte.
Als Byron nur die Lippen bewegte, beugte Fletcher sich zu seinem Herrn hinunter.
»Meine Tochter«, flüsterte Byron.
Aber schon im nächsten Moment bereute er seine Worte.
»Möchten Sie mir einen Brief an Lady Byron und die kleine Ada in London diktieren?«, fragte Fletcher, der das Schlimmste befürchtete.
Bei einem solchen Begehren konnte es sich nur um den letzten Willen eines Sterbenden handeln. Es war allgemein bekannt, dass Byron seine Frau verabscheute und ihr lediglich offizielle Kommuniqués sandte, auf die sie nur äußerst selten antwortete.
Aber Byron schüttelte nur leicht den Kopf.
Er wusste, dass dieser Mann, der ihm schon seit so vielen Jahren diente und der ihm in so vielen widrigen Situationen beigestanden hatte, als Einziger über die wahren Verhältnisse im Bilde war und diese letzte Bitte niemandem preisgeben würde.
»Hol mir Haidée«, sagte Byron. »Und auch den Jungen.«
Obwohl Fletcher sie bereits vorgewarnt hatte, versetzte es Haidée einen Stich, ihren Vater in diesem Zustand vorzufinden, so bleich und geschwächt, weißer noch als eine gekalkte Wand.
Als sie jetzt mit Kauri vor dem abgenutzten türkischen Bett stand, auf dem Fletcher sorgfältig die Kissen aufgeschüttelt hatte, traten ihr beinahe Tränen in die Augen. Sie hatte bereits den Mann verloren, von dem sie ihr ganzes Leben lang geglaubt hatte, er sei ihr Vater - Ali Pascha. Und jetzt siechte auch dieser Vater, von dessen Existenz sie erst vor wenig mehr als einem Jahr erfahren hatte, vor ihren Augen dahin.
In diesem Jahr hatte Byron alles riskiert und es mit viel List bewerkstelligt, sie in seiner Nähe zu haben und dennoch die Natur ihrer Beziehung geheim zu halten.
Zu seinen Täuschungsmanövern gehörte aber auch, dass er vor einigen Monaten, an seinem sechsunddreißigsten Geburtstag, einen Brief an seine Frau geschrieben hatte, »Lady B.«, wie er sie nannte, und ihr mitgeteilt hatte, er habe ein liebenswertes
und lebhaftes griechisches Mädchen mit dem Namen Hayatée kennengelernt, eine Kriegswaise, die nur wenig älter sei als ihre Tochter Ada. Es sei sein Wunsch, Hayatée zu adoptieren und nach England zu schicken, wo Lady B. ihr eine angemessene Erziehung zukommen lassen möge.
Natürlich hatte er zu diesem Thema nie eine Antwort erhalten. Aber die Spione, die die Post öffneten, so erzählte er Haidée, würden diese Pseudo-Adoption für eine weitere der typischen Schrullen des großzügigen Lords halten.
Haidées »Beziehung« zu Byron war inzwischen aufgrund von Gerüchten etabliert, und diese logen in Griechenland bekanntlich nie. Und jetzt, wo er im Sterben lag - ein Zeitpunkt, zu dem es unerlässlich war, dass sie
Weitere Kostenlose Bücher