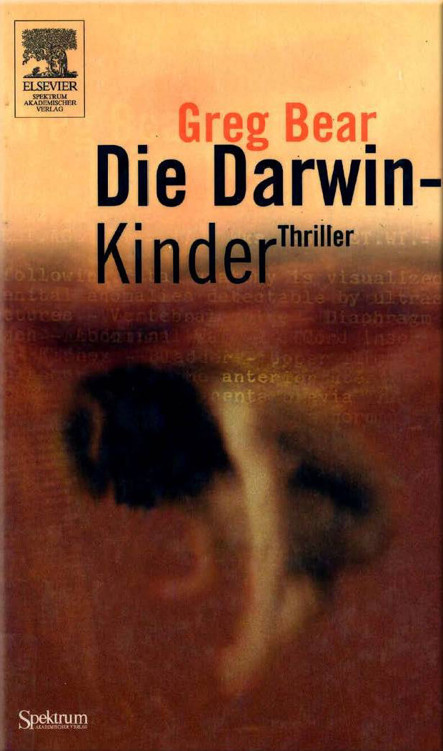![Die Darwin-Kinder]()
Die Darwin-Kinder
bewusst, denn sie drehte sich halb um und wandte den Blick von Stella ab und auf die Gipsverschalung, den Sims und den Anstrich. Ihre Augen tasteten die leeren Flächen so eingehend ab, als erkenne sie eine Schrift an der Wand.
»Ich glaube nicht, dass die das tun würden«, erklärte Stella.
»Was du glaubst oder nicht glaubst, ist hier nicht von Bedeutung«, gab Mitch zurück.
Verzweifelt verzog Stella das Gesicht zu einem verkrampften Lächeln, während ihr die Tränen kamen. »Wenn meine Meinung nicht zählt, wessen Meinung dann?«
»Jedenfalls zählt nicht einzig und allein deine Meinung, so weit sind wir noch nicht.« Mitch klang jetzt viel weicher. In seiner Stimme schwang so viel Qual, Zorn und Liebe mit, dass Stellas Kehle zu jucken anfing. Sie kratzte sich am Hals.
Kaye hob den Blick. »Verdammt«, sagte sie, als sei ihr plötzlich etwas eingefallen. Sie betrachtete ihre Finger und Nägel und hastete ins Bad, wo sie ihre Hände mehrere Minuten lang einseifte und abschrubbte. Das Bad war voller Dampf, als Stella an der Tür erschien.
»Machst du das wegen der Sache mit Fred?«
»Genau«, bestätigte Kaye voller Ingrimm.
»Du hast ihm ganz schön das Gesicht zerkratzt.«
»Wie eine Katzenmutter.« Kaye fuhr fort, sich mit einer harten kleinen Nagelbürste die Hände zu schrubben.
Schließlich blickte sie durch den Dampf und die Lavendeldüfte, die von der Seife hochstiegen, zur Decke empor. »Ich wasch mir den Kerl direkt von den Händen«, trällerte sie. Das war so wegseitig und vieldeutig, dass Stella ihre Schuldgefühle und den Frust vergaß und die Hände nach ihrer Mutter ausstreckte.
Kaye schlug die langen Arme ihrer Tochter zur Seite.
»Mutter«, sagte Stella schockiert. »Es tut mir Leid!« Als sie erneut die Hände ausstreckte, gab Kaye einen lauten Jammerton von sich und klatschte auf Stellas Hände, bis Stella sie mit einer schnellen Bewegung umfasste.
Während sich Mutter und Tochter auf den zerschlissenen Badeläufer plumpsen ließen – zu erschöpft, um irgendetwas zu tun, außer zu zittern und sich aneinander zu klammern –, holte Mitch tief Luft und erledigte alles Übrige. In einem zweiten Koffer verstaute er weitere Kleidung, zog den Reißverschluss zu und warf das Gepäckstück zusammen mit dem Müllbeutel in den Kofferraum des Dodge.
Dabei stellte er sich selbst als raubeinigen Vater in der Pionierzeit vor, der den Aufbruch aus dem schäbigen Haus und die überstürzte Flucht in die Wälder vorbereitete, weil die Indianer auf dem Kriegspfad waren.
Nur dass es keine Indianer waren. Sie hatten einige Zeit unter Indianern gelebt – Stella war im Krankenhaus eines Reservats im Staate Washington geboren. Mitch hatte sich jahrzehntelang mit indianischer Kultur befasst und bewunderte sie. Darüber hinaus hatte er in Nordamerika auch uralte Knochen ausgegraben. Er glaubte nicht, dass er so etwas heute noch tun würde.
Er fühlte sich nicht mehr wie ein Weißer, wollte so wenig wie möglich, am besten gar nichts mehr mit seiner eigenen Rasse und seiner eigenen Art zu tun haben.
Wovor er Angst hatte, waren nicht die Indianer. Es war die Kavallerie.
Sie nahmen den Dodge und ließen den alten grauen Laster in der ungepflasterten Einfahrt stehen. Kaye warf nicht einen Blick zurück aufs Haus, aber Stella, die neben ihrer Mutter auf der Rückbank saß, wirbelte herum.
»Dort haben wir Shamus begraben«, sagte sie. Der orangeweiß getigerte Shamus war vor drei Jahren in ihr Leben getreten – besser gesagt: gehumpelt. Er war ein alter, übel zugerichteter Kater, um dessen Hals irgendjemand einen Strick geschlungen hatte. Kaye hatte den Strick durchtrennt, sein zerfetztes Ohr zusammengenäht und über dem Auge einen Schnitt gemacht, damit der Eiter aus einer Wunde abfließen konnte.
Um Shamus davon abzuhalten, die Nähte aufzukratzen, hatte Mitch ihm einen Plastikschirm um den Kopf gebunden. Damit sah der Kater so komisch aus, dass Stella ihn Frankenpussi nannte.
Für einen halb verwilderten alten Kater war Shamus bemerkenswert lieb und zutraulich gewesen. Irgendwann im letzten Winter hatte sich Shamus, anders als sonst, abends nicht eingefunden, um sich seinen Teil des Essens zu sichern oder sein Schläfchen in Kayes Schoß zu halten. Der Kater hatte sich in die hinterste Ecke des Gartens verzogen, so weit weg, dass selbst Stellas Geruchssinn versagt hatte. Er hatte sich tief unter die dichten Rankengewächse geschoben und sich dort, gut verborgen vor den Krähen,
Weitere Kostenlose Bücher