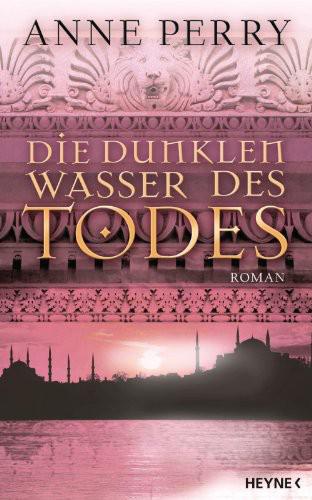![Die Dunklen Wasser Des Todes: Roman]()
Die Dunklen Wasser Des Todes: Roman
alten Familien finden. Es sind Menschen, auf die andere hören, bevor es zu spät ist.«
Anna spürte, wie sich ihr Magen zusammenkrampfte und Angstschweiß ihre Hände benetzte.
»Sicherlich gehört Zoe Chrysaphes zu ihnen«, sagte sie nachdenklich. »Sie hat großen Einfluss und könnte für Byzanz mehr bewirken als so mancher andere. Immerhin steht sie der Familie Komnenos ebenso nahe wie dem Kaiser.«
Er nickte leicht, wobei der Anflug eines Lächelns auf seine Lippen trat. »Wenn es mir gelingt, ihr klarzumachen, dass etwas den Segen der Heiligen Jungfrau hat, wird sie es
tun. Außerdem ist da noch Theodosia Skleros und ihre gesamte Verwandtschaft. Die Familie ist äußerst vermögend und unserem Glauben treu ergeben.« Seine Augen leuchteten, und er beugte sich näher zu Anna. »Ihr habt Recht, Anastasios, es besteht Grund zur Hoffnung, solange wir die Unerschrockenheit und den Glauben aufbringen, das Richtige zu tun. Ich danke Euch. Ihr habt mir Mut gemacht.«
Bei diesen Worten beschlich sie ein leiser Zweifel. War es denkbar, dass jemand, der allem Anschein nach ein Heiliger war, zu solch fragwürdigen Mitteln griff, ohne sich dabei zu beflecken? Die Fackeln brannten in ihren Haltern, und obwohl sich nicht der leiseste Luftzug regte, überlief sie mit einem Mal ein Frösteln.
Ein Zwiespalt plagte Anna. Zwar hatte sie Bischof Konstantinos vor einer Gefahr für Leib und Leben gewarnt, weil sie unbedingt auf den Mord an Bessarion zu sprechen kommen wollte, doch war ihre Furcht um ihn zum Teil echt, da ihr die in der Stadt herrschenden Spannungen bewusst waren. Sie gab sich keiner Täuschung darüber hin, dass sie mit Fragen wie denen, die sie ihm gestellt hatte, die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Auf keinen Fall durfte sie ihre Suche einstellen, doch war es ein Gebot der Vernunft, auf ihre Sicherheit zu achten. Zwar gab es für sie keinerlei Hindernisse, sich frei in der Stadt zu bewegen, da man sie für einen Eunuchen hielt, doch wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit zu einem Patienten gerufen wurde, ließ sie sich von Leo begleiten. Zum Glück kam das um diese Jahreszeit nur selten vor, denn die Nächte im Sommer waren kurz.
Da ihre Praxis so gut ging und sie überdies einen großen Teil ihres Medikamentenvorrats für die Behandlung von
Armen verbraucht hatte, ging er langsam zur Neige. Es wurde Zeit, ihn aufzufüllen.
Sie ging zum Hafen hinab, um nach Galata überzusetzen. Noch stand die Sonne hoch über den Hügeln im Westen; eine leichte Brise trug Salzgeruch herüber. Sie brauchte nicht lange zu warten, bis ein Fährboot kam. Die leichten Bewegungen des Bootes und der beständige Wellenschlag gegen seine Bordwand wirkten beruhigend, und sie entspannte sich. Sie lächelte den anderen Fahrgästen kurz zu, ohne sich und ihnen den Abend mit überflüssigen Gesprächen zu verderben.
Avram Schachar hieß sie wie bei ihren vorigen Besuchen willkommen und führte sie in das Hinterzimmer mit den Regalen und Schubladen voller Kräuter und anderer Substanzen.
Sie traf ihre Wahl und nahm gern an, als er sie einlud, mit seiner Familie zu Abend zu essen. Nach einer guten Mahlzeit setzten er und sie sich in den kleinen Garten, sprachen miteinander über frühere Ärzte, vor allem über den bedeutenden jüdischen Heilkundigen und Philosophen Maimonides, der im Jahr des Sturms der Kreuzfahrer auf Konstantinopel in Ägypten verschieden war.
»Ich verehre ihn sehr«, sagte Schachar, »wegen seines vierzehnbändigen Kommentars zur Thora, den er auf Arabisch verfasst hat. Er ist in Hispanien zur Welt gekommen, in El Andalus.«
»Ach, nicht in Arabien?«, fragte sie.
»Aber nein. Eigentlich hieß er Moses ben Maimon, und er musste das Land verlassen, weil die Almohaden von den Juden verlangten, dass sie zum Islam übertraten oder ins Exil gingen.«
Erschauernd sagte Anna: »Die Macht der Mohammedaner,
die im Süden und Westen von uns leben, scheint von Jahr zu Jahr zu wachsen.«
Schachar machte eine wegwerfende Handbewegung. »Wir haben schon heute genug Not und Elend, da solltet Ihr den Blick nicht auf das Morgen richten. Jetzt berichtet mir, wie es um Eure Arbeit steht.«
Es freute sie zu sehen, dass ihn ihr Wirken interessierte, und so beantwortete sie seine Fragen über die Behandlung des Kaisers, beschränkte sich aber darauf, zu sagen, dass sie um ihn fürchtete, weil im Volk wegen der Union mit Rom Missstimmung herrschte.
»Es ist eine hohe Ehre, ihn behandeln zu dürfen«, sagte er bedächtig, sah dabei
Weitere Kostenlose Bücher