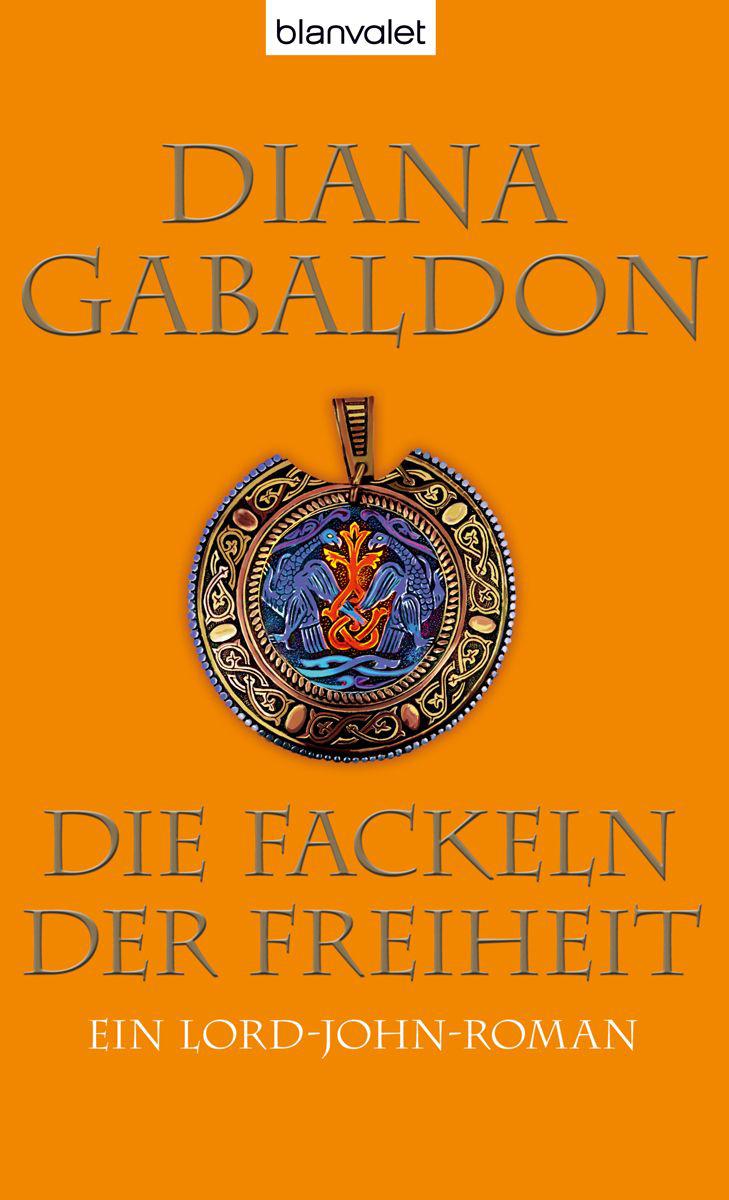![Die Fackeln der Freiheit: Ein Lord-John-Roman (German Edition)]()
Die Fackeln der Freiheit: Ein Lord-John-Roman (German Edition)
diese Ehe allein auf beiderseitigem Nutzen beruhte. Außerdem hätte er geschworen, dass Stephans Vorlieben sich in andere Richtungen bewegten. Es hatte Momente zwischen ihm und Stephan gegeben, die … Nun, es stimmte, es hatte sich nichts Explizites ereignet, keine Deklarationen – zumindest keine derartigen Deklarationen –, und doch konnte er sich unmöglich vollständig irren. Dieses Gefühl, das zwischen ihnen herrschte …
Er erinnerte sich an den Abend, an dem er Stephan im Freien geholfen hatte, sein Hemd auszuziehen, an dem er den Stumpf seines frisch amputierten linken Arms betrachtet – und geküsst – hatte, daran, wie die Haut des Mannes im magischen Licht der Dämmerung geleuchtet hatte. Sein Gesicht lief heiß an, und er beugte den Kopf über seinen Teller.
Dennoch. Möglich, dass Stephan aufrichtig an Louisa gehangen hatte, ganz gleich, wie die wahre Natur ihrer Ehe ausgesehen hatte. Und es gab ja Männer, die sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlten. Was das betraf, so kannte auch Grey diverse Frauen, deren Tod ihn zutiefst bestürzen würde, selbst wenn er keine andere Beziehung zu ihnen unterhielt als die der Freundschaft.
Von Namtzen kehrte zurück, als die Käseteller abgeräumt wurden, und schien zu seinem üblichen Gleichmut zurückgefunden zu haben, auch wenn seine Augen rot gerändert waren. Bei Port und Brandy schwenkte das Gespräch reibungslos erst zum Thema Pferderennen und dann zur Pferdezucht über – von Namtzen unterhielt ein bemerkenswertes Gestüt in Waldesruh – und verharrte auf neutralem Boden, bis sie sich schließlich erhoben.
»Soll ich dich nach Hause begleiten?«, fragte Grey von Namtzen leise, während sie im Flur darauf warteten, dass der Steward ihnen ihre Umhänge brachte. Er konnte sein Herz in seinen Ohren klopfen hören.
Stephans Blick huschte zu Frobisher hinüber, doch der Mann war ganz in sein Gespräch mit Harry vertieft.
»Ich würde die Gesellschaft sehr schätzen, Lord John«, sagte er, und obwohl die Worte formell klangen, war der Blick seiner rot geränderten Augen warm.
In der Kutsche sprachen sie nicht. Es hatte aufgehört zu regnen, und sie ließen die Fenster offen, die Luft wehte ihnen kalt und frisch in die Gesichter. Greys Gedanken waren ungeordnet – durch den Wein, den er zum Abendessen getrunken hatte, mehr noch durch den Tumult der Gefühle des heutigen Tages … und vor allem durch Stephan, so dicht in seiner Nähe. Er war ein kräftiger, hochgewachsener Mann, und seine Knie vibrierten mit den Bewegungen der Kutsche, dicht neben Greys.
Als er Stephan aus der Kutsche folgte, wehte ihm von Namtzens Duftwasser in die Nase, schwach und würzig – Nelken, dachte er, und fühlte sich absurd an Weihnachten erinnert und an mit Nelken besteckte Orangen, die ihren festlichen Duft im Haus verbreiteten.
Seine Hand schloss sich um die Orange, kühl und rund in seiner Tasche, und er dachte an andere rundliche Dinge, die in seine Hand passen würden, diesmal warm.
»Narr«, murmelte er zu sich selbst. »Denk erst gar nicht daran.«
Es war natürlich unmöglich, nicht daran zu denken.
Nachdem er den gähnenden Butler zu Bett geschickt hatte, der sie einließ, führte Stephan Grey in ein kleines Wohnzimmer, in dem die Kohle des Feuers noch im Kamin glühte. Er deutete auf einen bequemen Sessel und griff selbst nach dem Schüreisen, um die Glut wieder zum Leben zu erwecken.
»Möchtest du etwas trinken?«, fragte er und wies kopfnickend hinter sich auf eine Anrichte, auf der Gläser und Flaschen der Größe nach sortiert in Reih und Glied standen. Grey lächelte über die typisch deutsche Ordnung, doch er schenkte sich einen kleinen Brandy ein und – mit einem Blick auf Stephans breiten Rücken – einen etwas größeren für seinen Freund.
Einige der Flaschen waren halb leer, und er fragte sich, wie lange Stephan wohl schon in London war.
Sie nahmen vor dem Kamin Platz, tranken ihren Brandy in kameradschaftlichem Schweigen und beobachteten die Flammen.
»Es war gütig von dir, mit mir zu kommen«, sagte Stephan schließlich. »Ich wäre heute Abend nicht gern allein gewesen.«
Grey winkte schulterzuckend ab. »Ich bedaure höchstens, dass es eine Tragödie sein muss, die uns wieder zusammenführt«, sagte er, und es war auch so gemeint. »Fehlt … dir deine Frau sehr?«
Stephan spitzte ein wenig die Lippen. »Ich – nun … Natürlich trauere ich um Louisa«, sagte er um einiges förmlicher, als Grey es erwartet hätte. »Sie
Weitere Kostenlose Bücher