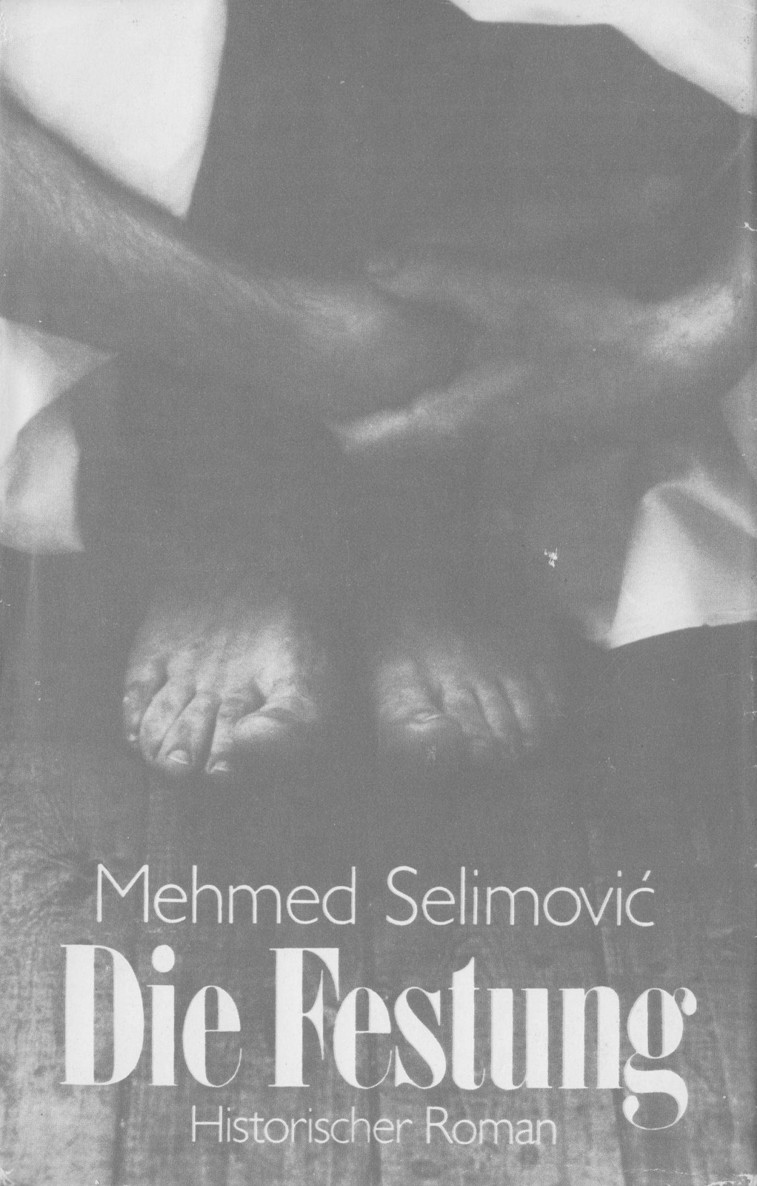![Die Festung]()
Die Festung
und
mich grämte, weil ich nicht wenigstens einen Teil ihrer Schmerzen auf mich
nehmen konnte, kam Mahmut mit einem Glas Limonade in der zitternden Hand
herein. Wer weiß, woher er das hatte, aber ich mußte gestehen, daß seine
vernünftige Sorge nützlicher war als meine Gefühlsseligkeit.
»Gib ihr das«, flüsterte er und
reichte mir das Glas.
Er bot mir eine Gelegenheit, auf
seine Kosten aufmerksam zu sein.
Ich hob ihren Kopf an, nötigte sie
sanft.
Sie trank in kurzen Schlucken,
gierig, als löschte sie ein inneres Feuer, und lächelte mich dankbar an.
Mahmut gönnte sie keinen Blick.
Dann schloß sie wieder die Augen.
»Sie wird jetzt kräftiges Essen
brauchen«, erinnerte mich Mahmut, als wir auf die Veranda traten.
Ich nickte, ja, sie brauchte kräftiges
Essen, obwohl ich nicht wußte, wie ich das beschaffen sollte.
»Und das Kind muß begraben werden.«
In einer Ecke der Veranda, in ein
blutiges Handtuch gewickelt, lag das, was einmal ein Kind gewesen war.
Auf dem Alifakovac begruben wir
dieses Häufchen Fleisch, dieses dritte Mitglied unserer Familie, das nicht
hatte geboren werden wollen. In dem Leichenzug, der nur aus Mahmut und mir
bestand, trug ich es auf einem Brett, bedeckt mit einem Stück Leinentuch, und
ich verscharrte es in einer fremden ewigen Ruhestätte neben ebenso fremden
alten Gebeinen.
»Er ist gestorben und war nicht
einmal geboren«, sagte Mahmut, und das war die ganze Leichenrede für dieses
kleine, namenlose Geschöpf, dem ich nicht mehr nachtrauerte. Es war die Freude
meiner Gedanken gewesen, solange ich es erwartete, jetzt war es nichts.
Ich erinnerte mich an die beiden
Söhne des Barbiers Salih, der hier, auf dem Alifakovac, zu Hause war, und ich
dachte, daß es besser war, einen Sohn nicht zu bekommen, als ihn in den Sümpfen bei Chotin zu
verlieren, wenn er erwachsen war. Denn dann wußte man schon, wer er war, man
hatte ihn liebgewonnen, und die Trauer war tiefer.
»Sicher«, bestätigte Mahmut. »Nur
daß Salih noch immer auf die Söhne wartet.«
»Glaubt er etwa, daß sie noch am
Leben sind?«
»Der Mensch glaubt, woran er glauben
will. Warst du bei ihm? Du solltest mal hingehen.«
»Was soll ich bei ihm? Was ihm
sagen?«
»Du wirst sagen, daß sie lebend
zurückgeblieben sind, nicht mehr. Was er sonst noch braucht, wird er sich dazudenken.«
»Vielleicht gehe ich wirklich hin.«
»Es wäre ein gutes Werk.«
Ich bat Mahmut, zu Tijana zu gehen
und die Nachbarin bei der Krankenwache abzulösen. Ich wollte zu Mula Ibrahim,
um mir etwas Geld zu leihen.
»Verlange etwas mehr. Ich habe auch
nichts. Die Kaufleute haben noch nicht bezahlt.«
Ich mußte lachen. Es wäre schon gut,
wenn er wenig gab, auf mehr bestand keine Hoffnung. Dieser Mahmut war seltsam,
er gab und nahm mit Leichtigkeit, ohne Rücksicht auf eigenen oder fremden
Besitz. Er hatte mich bestohlen, aber auch unterstützt, wobei die Diebstähle
nichtig waren, die Hilfeleistungen gewaltig: Sie hatten Tijana und mich
erhalten.
Ich wußte das, dennoch war ich ihm
weder besonders dankbar, noch erwartete er Dankbarkeit. Vielleicht weil in mir,
wenn auch unterdrückt, die Vorstellung von seiner Schuld und Verbannung, ja
sogar von seiner Minderwertigkeit lebte. Von anderen wußte er, daß sie so über
ihn dachten, von mir glücklicherweise nicht. Im Grunde dachte ich auch nicht
darüber nach, ich gestand es ihm insgeheim zu als sein besonderes Kennzeichen,
und ich schämte mich, wenn mir sein Vertrauen und meine Dummheit bewußt wurden.
Dann wieder vergaß ich alles.
Ich beleidigte ihn nie, mir war jede
Begegnung mit ihm angenehm, ich fühlte, daß sich dieses erwachsene Kind eine
ungewöhnliche Frische erhalten hatte, aber in Gedanken behandelte ich ihn
ungerecht.
Mula Ibrahim war nicht überrascht, als er mich sah. Als
hätte er gewußt, daß ich kommen würde, und als hätte alles seine Ordnung.
»Du bist nicht überrascht, als
hättest du gewußt, daß ich kommen würde.«
»Wir haben doch keinen Streit
miteinander. Warum solltest du nicht kommen?«
»Aber es paßt dir nicht.«
»Du bist heute mit dem linken Fuß
zuerst aufgestanden.«
»Auch wenn ich mit dem rechten
zuerst aufgestanden wäre, es würde mir nicht viel nützen.«
Ich spürte selbst, daß ich mich
unhöflich benahm. War es wegen der verratenen Freundschaft, der ich
nachtrauerte? Oder wegen seiner Güte: Der Mensch ist abscheulich und hält sich
an Wehrlosen schadlos.
Er war mir nicht böse, er wechselte
nur das Thema. »Wie
Weitere Kostenlose Bücher