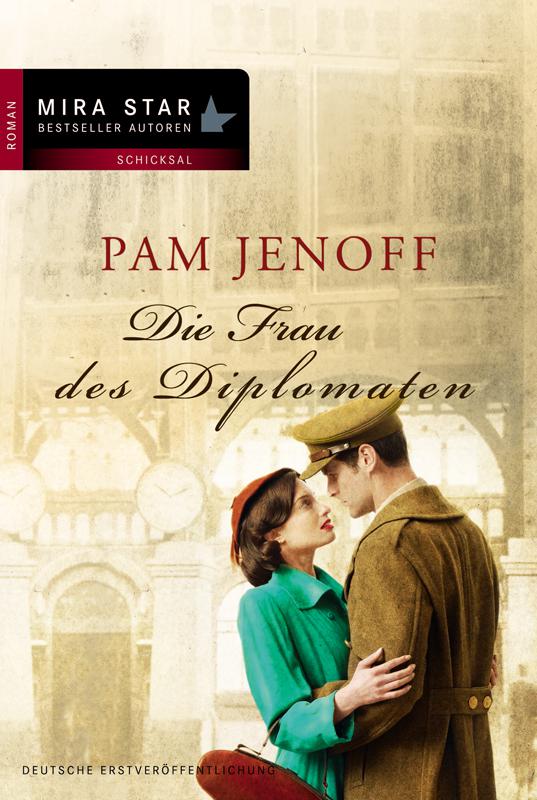![Die Frau des Diplomaten (German Edition)]()
Die Frau des Diplomaten (German Edition)
über die Wunde laufen, um sie vollständig zu säubern. Mit meiner Hand ersticke ich einen nur schwachen Schmerzensschrei, anschließend wickele ich den Stoffstreifen so fest um seinen Bauch, wie ich nur kann.
Bereits nach kurzer Zeit kann ich beobachten, dass wieder Blut aus der Wunde tritt. Doch es hilft nichts, es muss so genügen. Ich ziehe das Hemd nach unten und fühle seine Stirn, die glühend heiß und nass geschwitzt ist. Erneut spüre ich Panik in mir aufsteigen. Irgendetwas muss ich doch für ihn tun können. Auf einmal fällt mir die Feldflasche ein, aus der er mich hatte trinken lassen. Ich bete, dass er sie noch bei sich hat, greife behutsam um ihn herum und ertaste sie an seinem Gürtel. Als ich sie schüttele, merke ich, dass sich nur ein winziger Rest Wasser darin befindet. Paul würde wollen, dass wir das Wasser für später aufheben, wenn wir es dringender brauchen. Aber wenn ich nichts gegen sein Fieber unternehme, dann wird es vielleicht kein Später geben.
„Paul.“ Keine Reaktion. Ich schüttele ihn sanft und wiederhole seinen Namen, diesmal etwas lauter. Er grummelt, als würde er aus einem tiefen Schlaf erwachen. Vorsichtig fülle ich Wasser in den Deckel und halte ihn an seine Lippen, ganz so, wie er es bei mir gemacht hat, als er mich in meiner Zelle fand. Ich träufele ihm ein paar Tropfen Wasser in den Mund. „Schluck das“, bitte ich ihn, doch er zeigt keine Reaktion, und im nächsten Moment läuft ihm das Wasser wieder aus dem Mundwinkel. Behutsam lege ich seinen Kopf in den Nacken und unternehme einen weiteren Anlauf. „Trink“, fordere ich ihn auf, und jetzt sehe ich, wie sich sein Adamsapfel leicht bewegt. Den Rest aus dem Deckel verreibe ich auf seiner Stirn, um sie zu kühlen.
Nachdem ich die Feldflasche wieder zugeschraubt habe, mustere ich Pauls Gesicht. Mehr als das kann ich nicht für ihn tun. Da er zu zittern beginnt, lege ich vorsichtig einen Arm um ihn, schließe die Augen und hoffe, dass wir so schnell wie möglich England erreichen. Noch vor ein paar Stunden wollte ich eine Rückkehr so lange wie möglich hinauszögern, da unsere Ankunft zugleich unseren Abschied bedeutet hätte. Aber jetzt können wir gar nicht schnell genug heimkehren, damit die Hilfe für Paul nicht zu spät kommt. Ich werde dich nicht noch einmal verlieren, denke ich.
Die gleichmäßigen Bewegungen des Schiffes lassen mich immer müder werden. Eigentlich sollte ich wach bleiben, aber das ist plötzlich gar nicht mehr wichtig. Ob wir im Schlaf ertappt werden oder nicht, ist egal. Ich hätte ohnehin nicht mehr genug Kraft, um mich schützend vor Paul zu stellen. Wir haben getan, was wir konnten. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Jetzt hängt alles nur noch davon ab, ob wir es lebend zurück nach England schaffen. Langsam sinke ich in einen tiefen Schlaf.
Irgendwann später werde ich wach, da ich spüre, dass Paul sich bewegt. Ich setze mich auf und sehe ihn an. Die Augen hat er einen Spaltbreit geöffnet. „Kannst du mich hören?“, frage ich, und er nickt langsam. „Wie fühlst du dich?“
„Es tut weh“, gibt er zurück. „Sehr weh.“
„Ich weiß.“ Ich lege meine Hand auf seine Stirn, die noch heißer ist als zuvor. Dann greife ich nach der Feldflasche.
Er hebt abwehrend seine Hand. „Vergeude das Wasser nicht.“
„Paul, du glühst förmlich! Ich werde schon irgendwo Wasser auftreiben.“
Er erwidert nichts, sondern lässt sich von mir ein paar Tropfen einflößen, und verzieht dann das Gesicht, als er schluckt. Ich erinnere mich daran, wie ich im Gefängnis meine Schmerzen zu vergessen versuchte, indem ich so tat, als sei ich ganz woanders – bei meiner Familie im Dorf oder beim Schabbes-Essen mit meinen Freunden. „Lass uns so tun, als wären wir gar nicht hier“, sage ich zu ihm. „Denk zurück an die Nacht in Salzburg, als wir in der Gartenlaube saßen und dem Regen lauschten.“
Ein schwaches Lächeln huscht über seine Lippen. „Das war wunderschön. Diese Ruhe nach den Kämpfen. Ich dachte, ich wäre im Paradies.“ Dann wird seine Miene wieder ernst. „Im Krieg schaffte ich es, mich nicht ernsthaft verletzen zu lassen. Und jetzt …“ Er hebt seine Hand ein wenig in Richtung der Verletzung.
„Und alles nur meinetwegen“, murmele ich. „Sonst wärst du gar nicht hier. Es tut mir leid.“
„Das war es wert“, erwidert er rasch. „Ich liebe dich, Marta.“
„Und ich liebe dich. Als ich sah, was sich an der Einfahrt zum Hafen abspielte, da dachte ich
Weitere Kostenlose Bücher