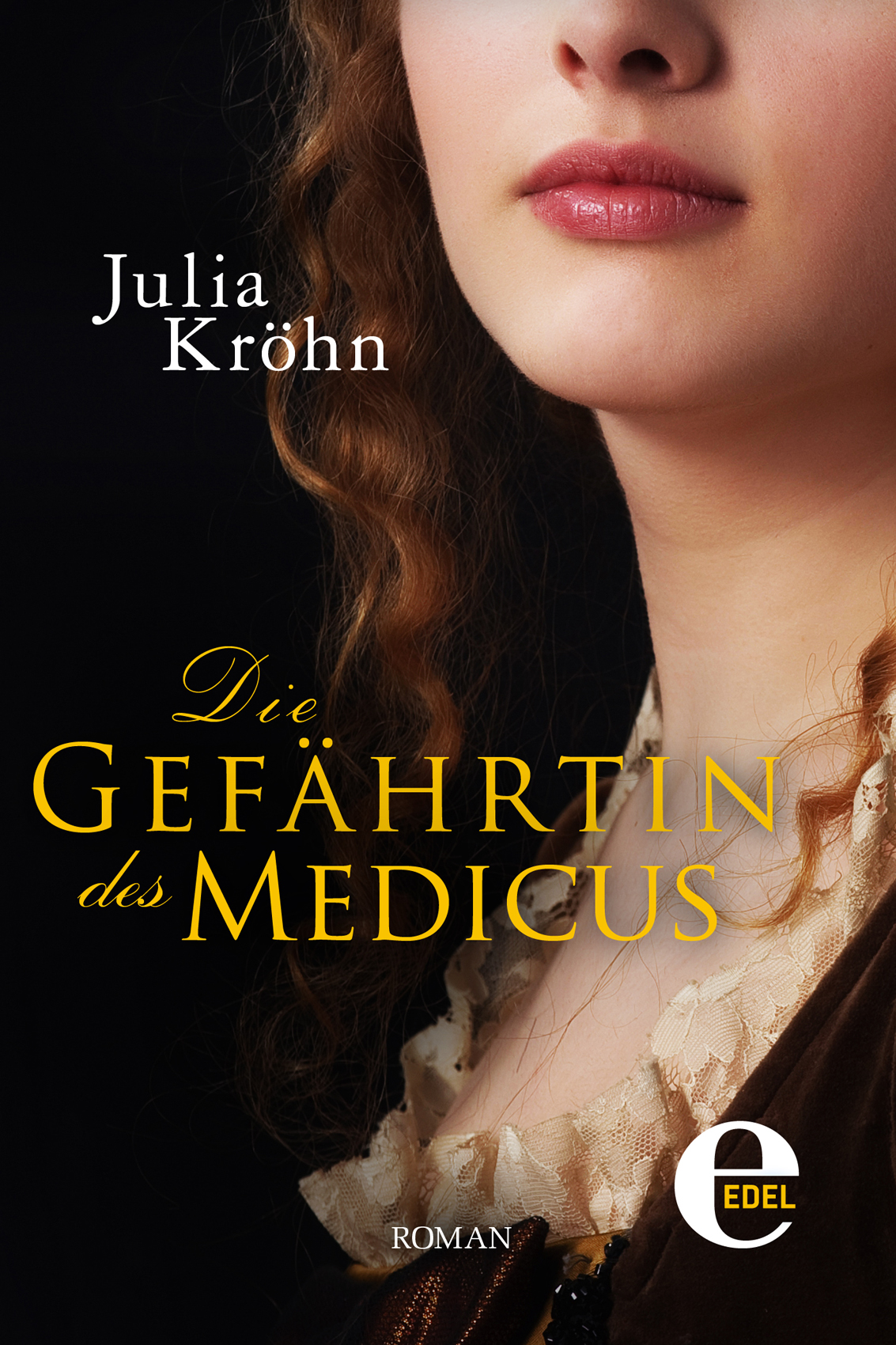![Die Gefährtin des Medicus]()
Die Gefährtin des Medicus
Stadtmauer, deren Graben mit Wasser gefüllt war und von dem man ein kleines Bächlein in einen Fischteich leitete, wurden Karpfen und Maifische gezüchtet. Eigentlich auch Forellen.
»Aber Forellen werden zurzeit in Avignon nicht gegessen!«, hatte Stephanus Johannis erklärt. »Der Papst kann sie nicht leiden.«
Stephanus gehörte der Teich, und er wachte strikt darüber, dass nicht ein gewöhnlicher Bürger Avignons oder auch nur eine freche Katze heimlich nach dem fischten, was ausschließlich für die Tafel des Heiligen Vaters bestimmt war.
Misstrauisch hatte er sich anfangs auch gegenüber Roselina und Alaïs gezeigt. Doch mit den Jahren hatte er gelernt, dass diebeiden satte Bäuche hatten und ihn nicht berauben wollten, sondern vielmehr an einem der wenigen Orte, die im brütend heißen Sommer zu ertragen waren, ein kühles Plätzchen suchten. Träge hockten sie am erdigen Rand des Teiches, auf dem Alaïs zunächst ein Stück Leinen ausbreitete, damit keine grünen Grasflecken auf Roselinas Kleid verblieben. Stephanus hatte sich in sein kleines Haus zurückgezogen – nicht nur ein Zeichen, dass er ihnen traute, sondern vor allem auch dafür, dass die Sonne dem Alternden zusetzte.
»Sollen wir ihn füttern?«, fragte Roselina und deutete auf den Fisch, der wieder Richtung Oberfläche gestiegen war, als spielte er mit ihnen.
»Er scheint mir fett genug«, erklärte Alaïs. »Der Papst mag mageres Fleisch, so heißt’s.«
In Avignon wurde viel über Essen gesprochen, nicht nur von Marguerite, die die nächtlichen Plünderungen der Speisekammer nicht aufgegeben hatte. Die Armen neideten den Reichen deren Köstlichkeiten. Die Reichen verglichen mit Argusaugen, was auf dem Tisch des Nachbarn landete. Und alle gemeinsam beredeten sie, was der Papst aß – ob beim letzten Festmahl mit ausländischen Gesandten oder während privater Tafeln.
Alaïs, die sich nachlässig gegen die Mauer gelehnt hatte, richtete sich auf. Die Schatten fielen nun tiefer, die Sonne strahlte nicht mehr senkrecht vom Himmel. Der Wind trieb zwar heiße Luft mit sich, aber immerhin stand er nicht mehr gänzlich still.
»Denkst du, er lässt sich anfassen?«, fragte Roselina und neigte sich tiefer über den Teich.
»Er würde sofort davonschwimmen. Und außerdem«, setzte Alaïs hinzu. »Und außerdem ist es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Dort zeigst du deiner Mutter, dass du dein weißes Kleidchen nicht schmutzig gemacht hast!«
Roselina verzog unwillig das Gesicht, doch es dauerte nicht lange, bis sich ihre Miene wieder glättete. Nie erwachte in dem Kind echter Widerstand gegen die strenge Mutter – vielleicht, weil es nicht aufrührerisch genug war, vielleicht, weil ihm dazuAlaïs’ Unterstützung fehlte. Diese konnte auch nach all den Jahren nur schwer fassen, dass eine so derbe, füllige Frau von ihrer Tochter verlangte, sich an der dreckigen Welt nicht zu beschmutzen. Aber im Zweifelsfall handelte sie, wie Marguerite es sich wünschte.
Nicht ungern verbrachte sie Zeit mit der Kleinen. So wie Marguerite ihr einst das Avignon der Nacht und seine eigenartigen Gesetze erklärt hatte, wusste ihr Roselina des Tags manch Stätte zu erschließen. Wie die Mutter war sie mit dem Talent ausgestattet, stets ein wenig mehr zu wissen als der Rest. Doch nach einer gewissen Zeit des Zusammenseins wurde Alaïs ihrer meist überdrüssig. Mit dem Kind zu reden war ihr nicht lästig, umso mehr jedoch, ständig darauf zu achten, dass sie auch sauber blieb.
»Warum denn jetzt schon?«, rief Roselina.
»Ich habe noch etwas zu tun …«
»Und was?«
Alaïs zuckte die Schultern. Das Schöne an ihrem Leben war, dass sie nichts tun musste, aber alles tun konnte und sich vor niemandem zu rechtfertigen hatte. Ihre einzige Pflicht war, Roselina zu erziehen, auf dass diese ordentlich zu essen lernte und ihre Sprache frei von Marguerites Derbheiten blieb.
Dafür bekam Alaïs die Nächte geschenkt, so viele Nächte, laute, schrille, berauschende, in stickigen Tavernen und unter weinseligen Männern, voller verbotener Scherze und Narreteien und Würfelspiel, das sie öfter verlor als gewann – was nichts machte, weil ein keckes Auflachen ihrerseits genügte, auf dass ihr die Schulden erlassen wurden.
Wie einst, als jener Christoph Bedesque um sie geworben hatte, warnte Marguerite auch später noch häufig: »Lass dir bloß keinen Bastard andrehen.«
Das hatte Alaïs ganz gewiss nicht vor, und dennoch war sie über die harschen Worte verwundert.
Weitere Kostenlose Bücher