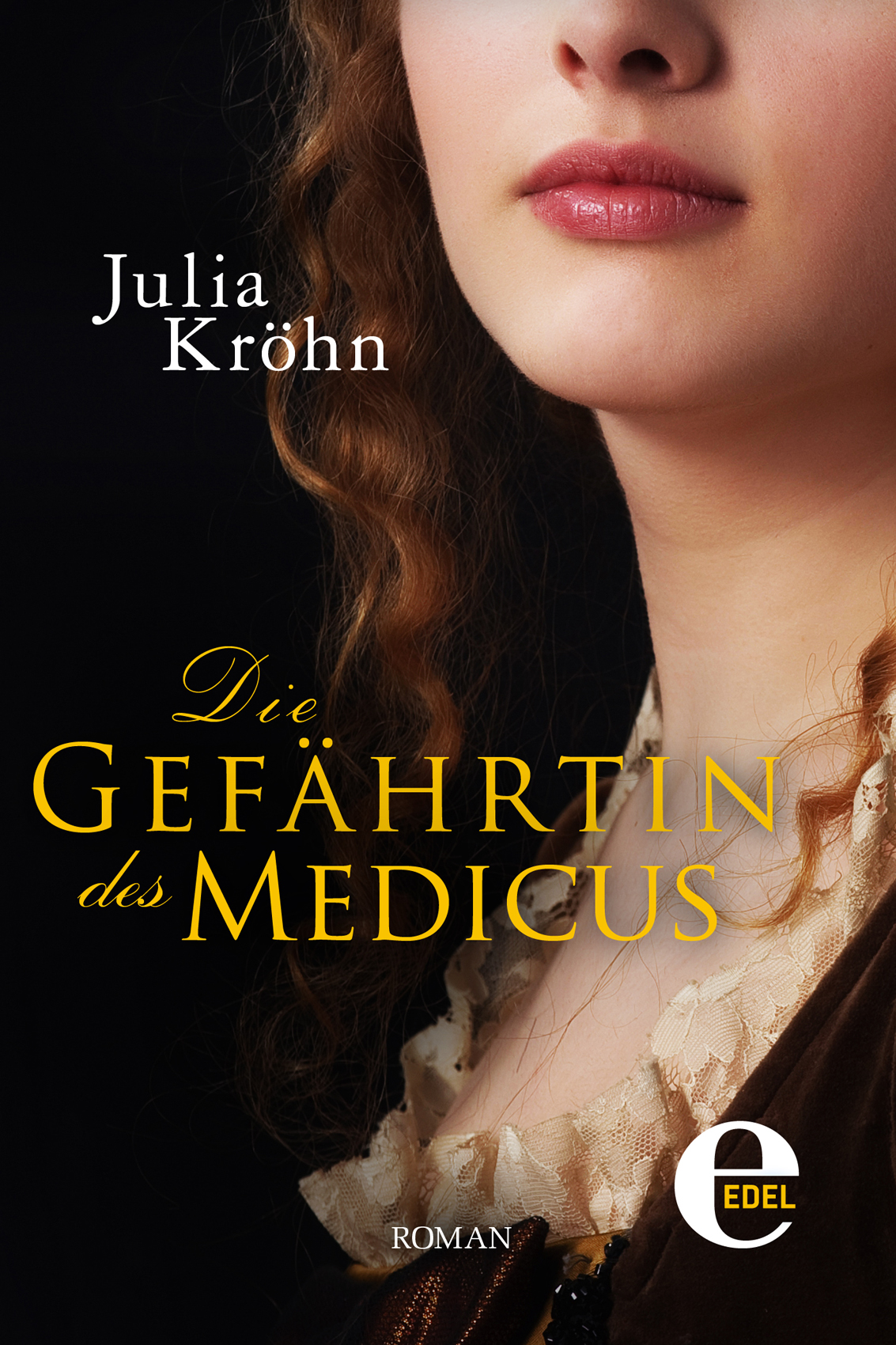![Die Gefährtin des Medicus]()
Die Gefährtin des Medicus
ihm zu beugen, seine Stirn zu befühlen.
Als sie ihn schließlich dennoch berührte, fing er an, wild um sich zu schlagen. Schmerzhaft war der Schlag, der sie in der Leibesmitte traf.
»Durst!«, stöhnte er. »Ich habe schrecklichen Durst.«
»Wir müssen das Fieber senken«, sagte Alaïs. »Am besten, wir geben ihm Gerstensaft. Und wir machen ihm einen Einlauf aus Kamille und Weizenkleie, etwas Salz und Honig …« Während sie sprach begann sie, sich ihrer Sache sicherer zu fühlen. Nicht wenigen raubte das Fieber das Leben, aber ebenso oft hatte sie miterlebt, wie es sich verjagen ließ. Wen es heimsuchte, der war schlimm getroffen, und bei diesem Armen schien es noch heißer zu brennen als bei anderen. Aber es war eine Heimsuchung, die zu bekämpfen nicht hoffnungslos war. Sie versuchte, nicht an jene Worte zu denken, mit denen Aurel irgendwann einmal den großen Avicenna zitiert hatte:
Es ist nicht möglich, ein Fieber zu heilen, dessen Ursache unbekannt ist.
»Und wir müssen frische Luft in diesen Raum lassen … wirf ein paar Kräuter ins Feuer, um …«
Mitten im Satz hielt sie inne. »Was zum Teufel …«, entfuhr es ihr.
Dulceta trat indes vorsichtig näher und schlug sich die Hände vors Gesicht. Während er sich unruhig wälzte, hatte sich Pierres Hemd hochgeschoben, gab seinen weißen Bauch mit der riesigen Narbe frei und auch die Leistengegend.
Ein Schaudern durchfuhr Alaïs.
Er hatte recht. Aurel hatte recht.
An Pierres Unterleib prangten, groß wie Taubeneier, rote Beulen.
Die Beulen wurden größer, wuchsen schließlich auf das Ausmaß von Hühnereiern an und verfärbten sich. Anfangs zog sich nur ein leichter Blauton über die Röte – so, als würden sie zu schimmeln beginnen. Dann wurde das Blau immer dunkler, bis es ins Schwarze überging. Nicht nur in der Leistengegend entdeckte Alaïs die Beulen, auch unter den Achseln und schließlich am Hals.
Er hatte recht. Aurel hatte recht.
»Mein Schädel … mein Schädel zerplatzt mir!«, stöhnte der Unglückliche immer wieder, bis sich seine Augen irgendwann ins Weiße verdrehten und das, was er sagte, keinen Sinn mehr machte. Er schrie die Namen von früh verstorbenen Geschwistern, erklärte, welche Fische sie gemeinsam gefangen hätten, obwohl sie das niemals getan hatten, und beschrieb die Fische als gefräßig und grausam. Mensch für Mensch hätten sie geschluckt, bis die Fische auf die Größe eines solchen angewachsen wären. Das Meer hätten sie verlassen, um auf ihren Flossen ins Dorf zu wandern und an ihm zu nagen.
So wild wälzte er sich auf seiner Schlafstatt, dass Alaïs schließlich Angst hatte, er könnte sich verletzen. Mit Dulceta band sie ihn fest, und er war zu geschwächt, um sich dagegen zu wehren, zerrte nur ein paar Mal mit den Händen an den Stricken, wodurch die Beulen in der Achselgegend ihnen förmlich ins Gesicht sprangen.
Angewidert wandte sich Dulceta ab. »Was … was ist das?«, stammelte sie.
Alaïs zuckte die Schultern. Manch eitriges Geschwür hatte sie in den letzten Jahren zum Reifen gebracht und schließlich aufgestochen, damit der sämig – gelbe Eiter herausfloss. Doch nie waren die Geschwüre so groß gewesen wie an Pierre, so dunkel und so zahlreich. Erstmals spielte sie mit dem Gedanken, Aurel um Hilfe zu bitten. Doch dann fiel ihr der hoffnungslose Klang seiner Stimme ein, als er bekundet hatte, man könne nichts gegen die Krankheit tun.
Wir werden alle sterben …
»Ich … ich schneide die Beulen auf«, entschied sie schließlich, als jene längst größer waren als ein Ei, ja, auf den Umfang eines Apfels angewachsen waren.
Dulceta bekreuzigte sich.
»Bist du sicher?«, fragte sie.
Als Alaïs sie anblickte, las sie Angst in ihren Augen – nicht nur um den Mann, wie ihr schien, auch um sich selbst.
Wie merkwürdig, dachte Alaïs. Nicht Dulcetas Furcht deuchte sie sonderbar, aber der Umstand, dass ihr selbst jede Furcht fehlte. Sie war nur wütend, unglaublich wütend, weil Aurel recht behalten hatte. Schlagen hätte sie ihn wollen, wäre er vor ihr gestanden – schlagen wollte sie auch diese fremde Krankheit.
»Ja! Ja, ich bin mir sicher«, sagte sie mit fester Stimme, neigte sich zu Pierre und griff nach jenem kleinen Messer, das sie stets am Gürtel trug. Emy hatte es ihr irgendwann einmal aus Marseille mitgebracht. Die Klinge war aus keinem so edlen Metall und auch nicht so scharf wie jenes, das Aurel einst benutzt hatte, um Menschen aufzuschneiden. Doch es genügte, um
Weitere Kostenlose Bücher