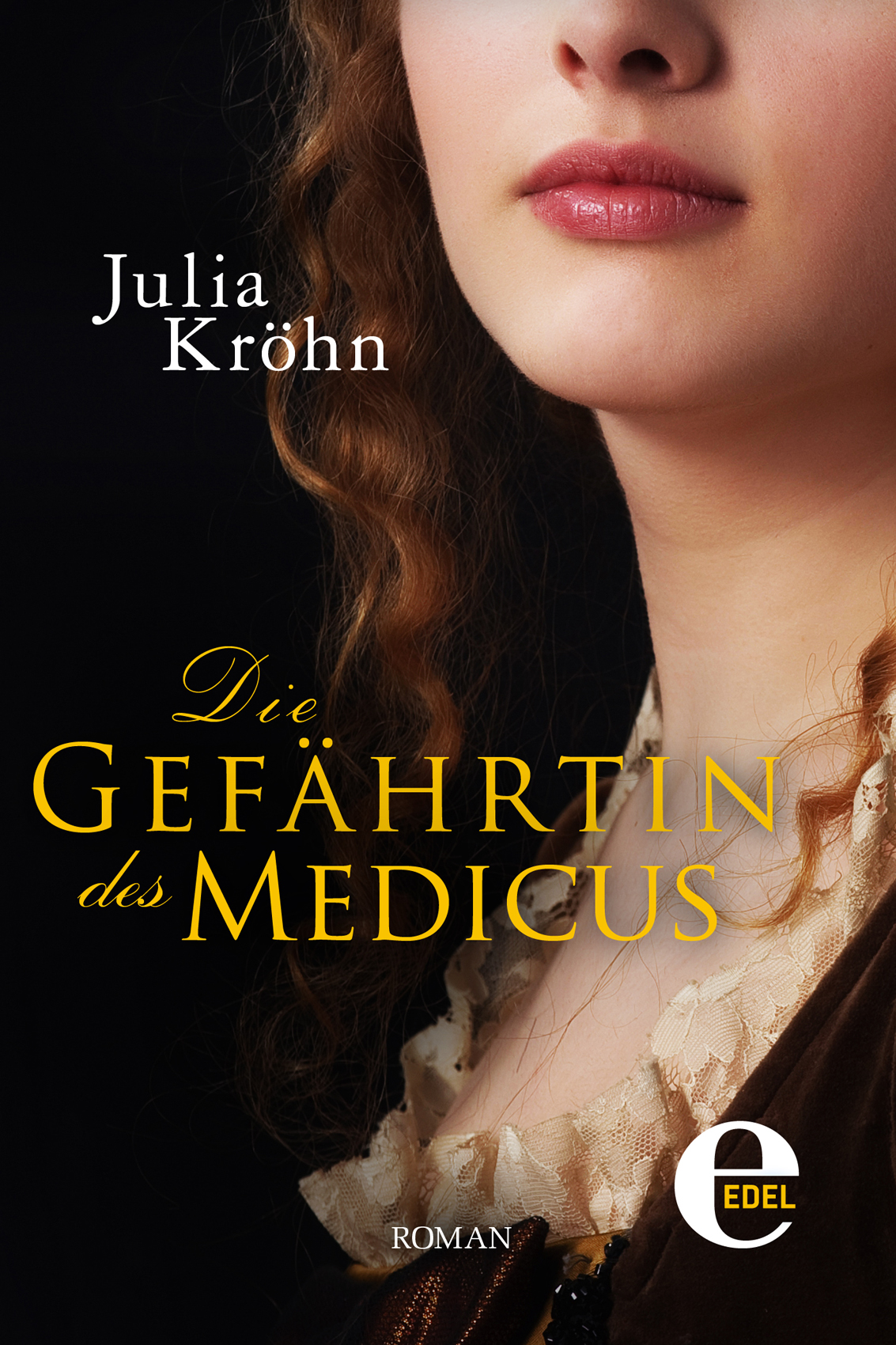![Die Gefährtin des Medicus]()
Die Gefährtin des Medicus
frei sein. Nicht ihr«, war das Letzte, was er sagte. Nackt war sein Gesicht, frei vom Freundlichen, Weichen, Höflichen. Er lächelte – und es glich jenem Triumphieren Aureis, als diesen das Schicksal noch nicht ausreichend darüber belehrt hatte, dass der Tod nicht immer das lautere, aber stets das endgültigere Wort spricht als das Leben.
Wenig später fiel Emy ins Delirium und fand das Bewusstsein nicht wieder. Sein Sterben war kein lautes Zerbersten, kein Klirren von Scherben eines zerplatzenden Gefäßes. Seine Kräfte rannen vielmehr sämig aus ihm heraus, so wie öl aus einem dunklen Krug, der lautlos zur Seite gekippt war. Er stöhnte, schwitzte und blutete zwar, aber er schlug nicht um sich. Im Morgengrauen hauchte er seinen Geist aus, und Alaïs schloss seine Augen, wusch seinen Körper, verkreuzte seine Arme über der Brust. Sie bedeckte ihn mit einem Leichentuch. Sie weinte immer noch.
Lange hockte sie bei dem Toten, konnte sich nicht aufraffen aufzustehen, sich zu reinigen, der Welt zu bekunden, dass sie Witwe war, und dafür zu sorgen, dass er begraben wurde, auch wenn der Friedhof längst zu klein geworden war für alle Toten von Saint – Marthe.
Doch sie wartete, wusste nicht, worauf; vielleicht darauf, selbst krank zu werden. Indessen die Luft dunstiger wurde, die Fliegen zahlreicher und ihr Durst dringlicher – nicht, weil sie Fieber bekam, sondern weil sie einfach schon zu lange nichts mehr getrunken hatte –, stellte sie fest, dass die Seuche sie nicht beachtete. Erst jetzt fiel ihr wieder ein, dass auch Aurel niedergebrochen war und dass er sie flehentlich um Wasser gebeten hatte. Wahrscheinlich bedurfte er dessen noch dringender als sie – so er denn noch lebte.
Endlich erhob sie sich, jedoch nicht, um dem
Cyrurgicus
Wasser zu bringen.
Raymonda, dachte sie, ich muss es Raymonda sagen …
Dass Emy tot ist und dass er friedlich gestorben ist.
Dass wir uns ausgesprochen haben. Dass es so etwas wie Versöhnung gab. Dass er endlich sein Schweigen aufgab.
Nein, Letzteres würde sie Raymonda nicht anvertrauen. Womöglich würde sie ihr nicht glauben, womöglich ging es sie auch nichts an. Aber sie selbst fühlte sich jäh von einem tiefen Frieden erfüllt, als hätte sich in ihrem Leib ein lange sitzender Knoten gelöst.
Leichtfüßig trat sie nach draußen, gewahrte jetzt erst, dass sie die ganze Nacht durchwacht hatte. Still und wie ausgestorben lag das Dorf vor ihr. Ein jeder schien sich in sein Haus zurückgezogen zu haben; niemanden gab es, der öffentlich klagte oder litt. Kurz war es möglich, sich selbst zu belügen, sich zu sagen, dass nicht Krankheit und Furcht die Leute einsperrten, sondern das Bedürfnis nach Ruhe.
Doch die Macht der Wahrheit, die das große Sterben ebenso mit sich brachte wie die verpestete Luft, war stärker. Als Alaïs Raymondas Haus erreichte, schrie sie auf. Vor der Tür standen Josse – der Sohn jenes Mannes, der Alaïs einst zur Frau begehrt hatte – und Ricard, der Enkel jenes Alten, den Aurel mit Emys Hilfe aus dem Grab gestohlen und aufgeschnitten hatte. Sie gehörten zu den Jungen, den Kräftigen und – was in diesen Tagen vor allem zählte – bislang Gesunden des Dorfes, und ihr trauriger Dienst war es, mit einem Wagen die Toten einzusammeln und zu bestatten.
Dass sie hier waren, konnte nur eines verheißen: Der Tod hatte auch in Andrius Familie zugeschlagen.
Alaïs stürzte hinein. »Wer?«, stammelte sie. »Wer?«
Sie blickte sich um, weit und breit war nichts von den Kindern zu sehen.
»Régine!«, schrie sie. »Gaspard!«
»Ich habe sie nach oben geschickt«, ertönte eine Stimme. »Ich wollte nicht, dass sie ihn schreien hören.«
Alaïs fuhr herum. Raymonda hockte neben der Feuerstelle, war dort niedergesunken.
»Raymonda …«, setzte sie heiser an.
»Andriu«, sagte jene schlicht und bekundete damit noch vor Alaïs, dass sie zur Witwe geworden war. Für einen kurzen Augenblick stand das Gesicht des gutmütigen Schwiegersohns ganz eindringlich vor ihr. Sie hatte ihn immer für schlicht gehalten und sich oft gefragt, warum die Tochter zu einem Mann geflohen war, der so viel schwafelte und besonders häufig fragte, ob ihr das Essen schmeckte. Doch nun streifte sie die Ahnung von Trauer – nicht, weil sie Andriu für sonderlich wertvoll gehalten hatte, sondern weil er in allem, was er tat, so berechenbar gewesen war. Er hatte mit keinem seiner Wesenszüge überrascht. Man wusste, was man von ihm erwarten konnte und was
Weitere Kostenlose Bücher