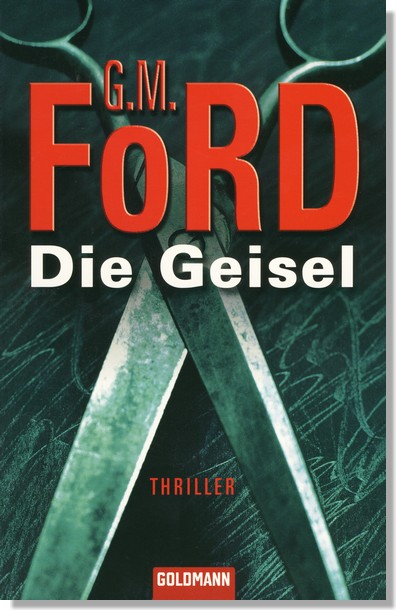![Die Geisel]()
Die Geisel
dass sie den Ton abgedreht hatte. Die automatische Untertitelfunktion sprang an, und die Wörter erschienen jetzt unten auf dem Bildschirm. Iris musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszulachen.
Offensichtlich empfand Mr. Asuega anders. Sein Gesicht nahm die Farbe einer Aubergine an, als er zusah, wie die flackernden Bilder über den Bildschirm tanzten. Wie hypnotisiert standen sie da und lasen mit offenen Mündern die kleinen weißen Wörter, sobald sie auf dem Bildschirm erschienen. Iris versuchte erst gar nicht mitzulesen. Die Wörter waren für sie sowieso immer zu schnell. Sie legte die Hand vor den Mund, um ihr Amüsement zu verbergen.
Dann erschienen die Blauhemden. In zwei Reihen kamen sie aus den Türen heraus, winkten mit hoch erhobenen Händen wie Kinder in einem Theaterstück. Soldaten, die Gewehre im Anschlag, trotteten dicht neben ihnen her, drängten sie vorwärts und bildeten eine fast undurchdringliche Reihe zwischen den Blauhemden und den nackten Gefangenen.
»Sie haben die Geiseln gerettet«, sagte Elias Romero.
»Gott sei Dank«, flüsterte jemand.
»Wie viele?«, fragte eine andere Stimme.
»Warum halten sie die Hände hoch?«, fragte Asuega. »Das sieht ja aus, als hätten sie irgendwas angestellt.« Er zeigte auf den Bildschirm, wo die Kamera weit genug weggezoomt hatte, um zu zeigen, wie die blau gekleideten Männer und Frauen am Zaun aufgereiht wurden. Mit gespreizten Beinen, die Hände am Drahtgeflecht, wie es die Cops immer von den Leuten verlangten. Asuega war jetzt richtig aufgebracht. »Sehen Sie nur! Was machen die denn da? Warum müssen sie sich so aufstellen?«
Niemand antwortete. Sie standen in dem sonnendurchfluteten Raum und schauten in den kleinen Kasten mit den Bildern von den Wachleuten, die paarweise nebeneinander wie Kälber von einer Rampe aus dem Zellenblock kamen und sich dann am Zaun aufreihten. Die Reihe schien kein Ende zu nehmen, bis die Farbe von Blau zu Weiß wechselte.
»Das Küchenpersonal«, sagte jemand.
Und dann kam Grau. »Instandhaltung und Reinigung«, erklärte Romero. Ein Lächeln erhellte sein großes rundes Gesicht. »Sieht aus, als hätten sie die meisten gerettet«, sagte er hoffnungsvoll. Als er die Augen schloss und ein leises Dankgebet vor sich hin murmelte, mochte Iris ihn für einen Augenblick wieder. Das änderte sich, sobald er erneut den Mund aufmachte. »Wir fangen besser an zu telefonieren«, schlug er vor. »Es wär doch nicht schön, wenn jemand aus dem Fernsehen vom Schicksal eines Angehörigen erfährt.«
Zustimmendes Gemurmel erhob sich.
»Iris …«, fing er an. Sie war schon auf dem Weg zu ihm, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern. Um ihm zu sagen, dass sie niemanden zu Hause erreichen würden, weil schon alle draußen auf der Zufahrtsstraße waren, hinter den Barrikaden und den Soldaten, und darauf warteten zu erfahren, was mit ihren Lieben geschehen war; doch so weit kam sie nicht, weil die Tür mit einem Knall aufflog.
Colonel Williams hatte auf einer Wange einen schwarzen Fleck und eine blutige Schramme auf dem linken Handrücken. Er warf seine Lederhandschuhe in seinen Helm und klemmte ihn sich unter den Arm. Sein dickes, dunkelblondes Haar war schweißgetränkt. Als er knapp in die Runde nickte, flogen Schweißtropfen von seiner Nase. Er wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht, ertappte sich selbst dabei und hielt inne. »Ich brauche die Personalakten«, verkündete er. »Alles, was irgendwie offiziell ist und wo ein Foto dabei ist.«
Asuega trat vor. Er zeigte auf den Fernseher. »Was soll das?«
»Das sind meine Leute, die gerade Ihre Arbeit machen«, sagte Williams. »Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, wir haben Ihre Geiseln für Sie rausgeholt.«
»Wie viele?«
»Das versuchen wir gerade herauszufinden.« Er richtete den Blick auf Elias Romero. »Die Akten?«
Romero zuckte resigniert die Achseln. »Die wurden im Verwaltungsgebäude aufbewahrt.« Er zeigte auf den Fernseher und zuckte wieder die Achseln.
Williams stieß ein kurzes Lachen aus, als wollte er sagen: »Hab ich's mir doch gedacht!« Bevor er überlegen konnte, was er jetzt tun sollte, pflanzte Asuega sich direkt vor ihm auf.
»Wieso werden unsere Angestellten behandelt wie gemeine Kriminelle?«
»Weil einige wahrscheinlich welche sind«, antwortete der Colonel. »Ich habe soeben zwanzig Leute mehr gerettet, als eigentlich vermisst wurden, und ich wette, dass ein paar von denen Sträflinge sind. Ergo geht niemand irgendwohin, solange ich
Weitere Kostenlose Bücher