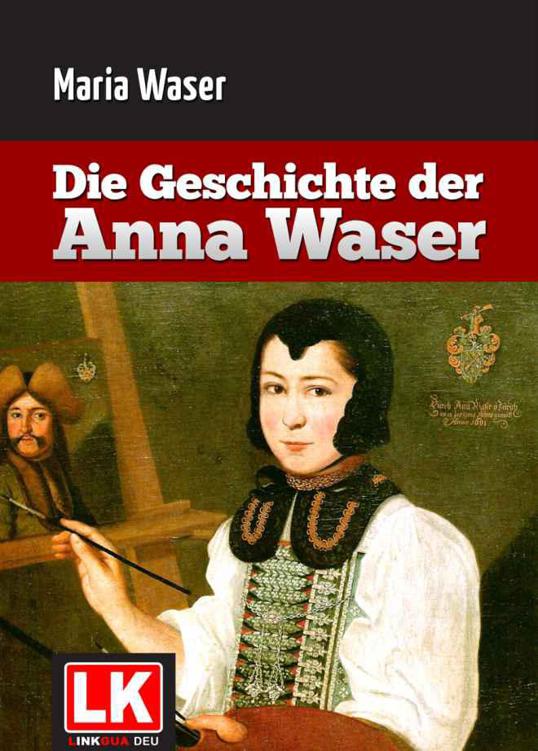![Die Geschichte der Anna Waser (German Edition)]()
Die Geschichte der Anna Waser (German Edition)
nicht heut machen lassen und nicht morgen. Aber wenigstens das andere: aufs Geldverdienen hin sollst nimmer arbeiten müssen; für was hat der Rudolf einen alten unbeweibten Oncle, als damit er ihm beispringe in solchen Läuften? Nimmer überschaffen sollst dich fürderhin, siehst ja bald zarter aus denn die Lisabeth und fast rot die lieben Augen! Und Totensprüch sollst auch nimmer malen für so diskutable Engel; wollen sehen, ob dann nicht deine Entwürf doch ausführen kannst, wann wieder Zeit hast und Schnauf und klare gesunde Augen, auch ohne den Lehrmeister und die äußeren Ort.“
Er erhob sich, schier leicht; als aber Anna voller Dankbarkeit ihm um den Hals fiel, wehrte er ihr fast verlegen: „Nicht, nicht, Meiti, etwan früher reden hätt’st können; so ein alter Oncle, schließlich ist man auch für etwas zu brauchen.“ Er legte seine Hand um ihre Schulter, und während er mit ihr im Zimmer auf-und abging, mit kleinen, etwas aufgeregten Schritten, beredeten sie den Plan, freudvoll und voller Hoffnung, wie zwei glückliche Kinder, wie es kommen sollte und wie es einzufädeln sei beim Vater. Klug mußte man sein und vorsichtig, und so durfte man beileibe nicht jetzt gerade mit dem Gestrengen reden, da er von allerhand mühseligen Amtsgängen und erschwerten Herbstgeschäften jeweilen einen unlustigen, nicht eben zugänglichen und fast eigensinnigen Kopf heimtrug. Aber bis in zwei Wochen, da war das Schlimmste für, da konnte man’s schon wagen. Und zwei Wochen, das war schließlich keine Ewigkeit mehr.
Als Anna wieder allein war und sie daran ging, mit Bürste und Schaufel die Spuren von Onkels erdbeschwerten Schuhen vom blanken Boden zu tilgen, betrachtete sie nicht ohne Rührung die breiten Tritte, die in lustiger Unordnung über die Diele verstreut lagen und sich vor der Truhe in zwei stattlichen, weit auseinander liegenden Häuflein verdichteten, und fast tat es ihr leid um diese lebendigen Zeugen einer schönen und wichtigen Stunde. Der liebe Mensch! Nun konnte doch alles wieder anders werden und besser. Sie rechnete aus: In zwei Wochen, da war’s kaum Mitte November, und der lange, lange Winter lag noch vor ihr!
Aber am vierzehnten November lag der Onkel Fähndrich im Todbett. Ganz plötzlich war es gekommen. Am Abend hatte er sich gesund niedergelegt und ein lustiges Liedlein gepfiffen dazu; als er aber am Morgen nicht aufstehen gewollt und Maria nach ihm sehen ging, lag er schon weiß und starr auf seinem harten Lager, und man erkannte, daß er vor etlichen Stunden allbereits den Geist aufgegeben hatte. Und weil er sich also still und ohne Abschied davongemacht, kam es wohl, daß keiner an seinen Tod glauben konnte und daß man immer wieder vermeinte, des Fähndrichs tiefes Lachen und festen Schritt irgendwo zu vernehmen, auch dann noch, als man ihn bereits in die Erde gelegt mit schönen Ehren, wobei der Onkel Pfarrer gar einen beweglichen Sermon gehalten, und als sich schon ein breiter und ruhiger Hügel über seiner letzten Wohnstatt wölbte. Auch da noch erschien es Anna wie ein Traum, wie ein schlimmer, schlimmer Traum, daraus sie hätte erwachen müssen. Und wann der Sonnabend kam und die Stunde, wo sonst sein lustiger Pfiff von der Napfgasse zu ihr herauf getönt, da setzte sie sich wohl auf die alte Truhe, als ob er neben sie hätt’ kommen müssen, und überließ sich ihrem warmen aufquellenden Herzweh. Ach, sie hatte nicht bloß den Onkel verloren wie die andern, den guten rauen Menschen mit der feinen Seele und den klugen vorschauenden Augen; wo war nun der Mensch, der sie so liebte, wie ein Kind zugleich und wie eine Freundin — und der sie verstand? Ja, den Freund hatte sie verloren und mit ihm ein Glück, eine Hoffnung und vielleicht einen Glauben — oder wie war es, stimmte es nun auch wirklich mit dem guten Tod? Der Onkel hatte ihr so oft etwas angedeutet von Plänen, von einem großen Werke, darein er sein Bestes gelegt, sein halbes Leben. Was war nun damit geschehen? Lag es vielleicht irgendwo unfertig, abgebrochen und sinnlos? Ja, und was war es dann mit dem guten, zeitrichtigen Tod?
Eines Tages rief sie der Amtmann in seine Stube. Als sie eintrat schlug ihr ein brenzlicher Geruch entgegen, der Vater aber stand neben dem Ofen mit blassen, angegriffenen Zügen und wie gebeugt die hagere Gestalt. „Hol den Aschenkessel!“ befahl er barsch. „Der Ofen muß geräumt werden, ich hab’ etwas verbrannt!“
Als sie das Eisentürchen öffnete, sah sie, wie das Innere
Weitere Kostenlose Bücher