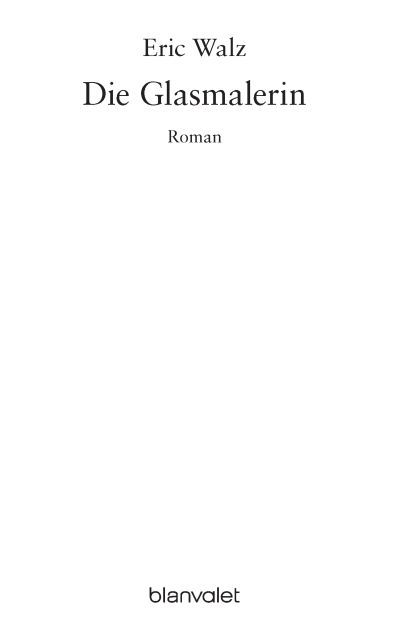![Die Glasmalerin - Walz, E: Glasmalerin]()
Die Glasmalerin - Walz, E: Glasmalerin
nicht mehr geschlossen, Taufen untersagt, die Toten nicht mehr bestattet, solange das Böse nicht aufgespürt worden sei. Todkranke fürchteten um ihren Einzug ins Paradies, Sünder um die wohltuende Möglichkeit, Sünden abzugeben, Mütter um Gottes Segen für ihre Kinder. Jene, die es sich erlauben konnten, verließen Trient. Kaufleute ohne dringende Geschäfte machten sich auf den Weg nach Innsbruck, Verona oder Padua. Ein Toter war gut für das Geschäft, da der Tod Leute aus den umliegenden Städtchen anlockte. Zwei Tote mussten nicht sein, schadeten allerdings nicht. Drei Tote waren zu viel. Nein, drei Tote waren nicht mehr schön.
Das dachten sich auch die Teilnehmer des Konzils. Der Kardinal Marcello Creszenzio versuchte, auf der morgendlichen Sitzung die vorgesehene Tagesordnung durchzusetzen, sah sich aber bald besorgten Nachfragen, leise geäußerten Klagen und schließlich aufgebrachter Empörung ausgesetzt, wie man es verantworten könne, unter diesen Umständen überhaupt noch weiterhin zu tagen. Erste Stimmen verlangten eine Unterbrechung des Konzils. Nicht der Konzilssitzung, nein, des gesamten Konzils. Andere forderten eine Verlegung nach Bologna oder Mailand, und einige gingen sogar so weit, das Konzil für gescheitert zu erklären. Der Abt von St. Flour und die Bischöfe von Turin und Cosenza erkrankten urplötzlich und bedauerten, ihren Aufenthalt abbrechen zu müssen. Kardinal Rowlands wiederum ergriff das Wort und beschuldigte indirekt den Papst, für »die ganze Situation« verantwortlich zu sein, was immer er damit meinte. Heftige Diskussionen waren die Folge, in deren Verlauf es zu tumultartigen Szenen kam. Ein sizilianischer Kanoniker und ein Protestant aus Jena beschimpften sich mit üblen Worten, ohne sich zu verstehen, die ersten Stühle kippten um, einige Delegierte flohen, einige beteten, einige schrien – und Creszenzio sank auf seinem Sessel zusammen, als wolle er auseinanderfließen. Das ersehnte, dringend benötigte Konzil von Trient stand unmittelbar vor dem Abbruch.
Als Antonia die Stadt betrat, läuteten die Glocken sämtlicher Kirchen, und sie läuteten weiter und weiter, als wenn sie versuchen wollten, das Böse mittels ihres Klangs zu vertreiben. Zahllose Geistliche hasteten über das Pflaster, stoben wie Wasser auseinander, in das man hineingeschlagen hatte, verteilten sich in die Gassen, flossen dahin, versickerten hinter Türen. Fensterläden schlossen sich, Marktstände verschwanden, das Geräusch eiserner Riegel war von überallher zu hören. Ein paar Übriggebliebene standen in Eingängen und flüsterten: dem Gefolge, das sich der Stadt nähere, werde das Wappen des Papstes vorangetragen. Julius III. war keine Stunde mehr entfernt, und niemand wusste, was er mitbringen würde, die Gnade oder die Unerbittlichkeit.
In der Casa Volterra öffnete der Diener Antonia die Tür, der ihr kürzlich die Speisen serviert hatte, ein Mann mit der Ausstrahlung eines Friedhofsgräbers. Überhaupt kam ihr heute alles anders vor als noch neulich Abend. Es duftete nicht. Die Treppe knarrte unangenehm. In dem Zimmer, in das man sie führte, hatte sie gespeist, doch jetzt fehlten das Kristall, der Paracelsus, die Poesie, ganz so, als hätte man eine Theaterkulisse abgeräumt und durch nichts anderes ersetzt. Lag es nur am trüben, grauen Licht? Bei Kerzenschein muten die Dinge immer intimer, bequemer, verschwiegener an. Bildete sie sich das alles nur ein? Wieso musste sie, während sie auf Matthias wartete, immerzu an das Haus seines Vaters Berthold denken?
Sie hatte Berthold nie leiden können, und wenn man unentwegt an ungeliebte Menschen denken muss, wird man von Kälte ergriffen. Dieses Zimmer flößte ihr unbestimmte Angst ein.
Die Tür zum Nebenzimmer war geschlossen, aber nicht ver schlossen. Hier war es etwas besser. Ein großer Schreibtisch war mit Papieren überladen, die allerdings sortiert waren wie eine Schlachtordnung. Ein mit schimmernder grüner Seide überzogener Stuhl, drei Porträts italienischer Familien mit Gesichtern des letzten Jahrhunderts, ein Bett und vor allem der für Matthias typische Geruch von Seife sorgten dafür, dass sie sich wohler fühlte.
Sie nahm auf dem Stuhl Platz. Vor ihr – sie konnte ihn nicht übersehen – lag ein geöffneter Brief des Herzogs von Württemberg. Schon die Anrede machte neugierig: Mein lieber Hagen! So redete ein Fürst nur, wenn es sich um einen Freund handelte. Oder um jemanden, den er sehr brauchte. Mein lieber Hagen, das
Weitere Kostenlose Bücher