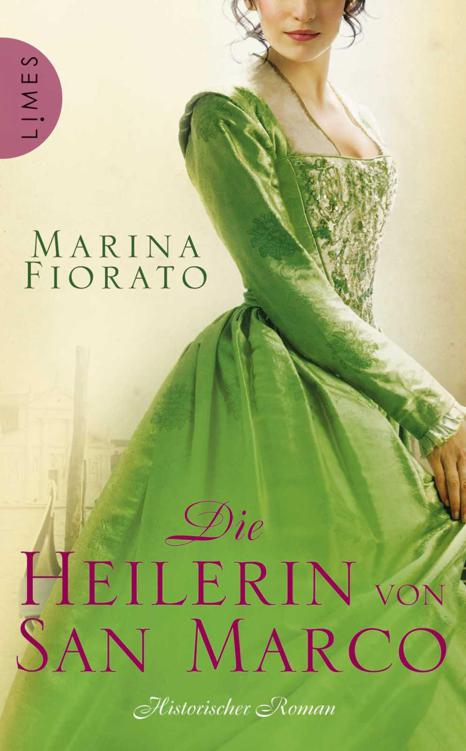![Die Heilerin von San Marco: Historischer Roman (German Edition)]()
Die Heilerin von San Marco: Historischer Roman (German Edition)
vernichten, ohne sich selbst die Hände schmutzig machen zu müssen und ohne großen bürokratischen Aufwand.
Bürokratie gehörte wirklich zu den lästigsten Dingen in Venedig.
40
Die Abreise der Schwestern war der erste von vielen Abschieden auf Lazzaretto Nuovo.
Eine nach der anderen kehrten die Familien nach Hause zurück, um ihr altes Leben in Venedig und dem quartiere Miracoli wieder aufzunehmen. Nur die Triannis wohnten noch in den Armenhäusern, und das aus einem ganz bestimmten Grund.
Die Badessa hatte ihnen mitteilen lassen, dass es ein kleines Problem gab. Das Trianni-Haus, das rechts von der Kirche Santa Maria dei Miracoli lag, war momentan bewohnt. Feyra sprach mit Schwester Benedetta, die die Nachricht überbracht hatte, während die stämmige Nonne ihr Boot am Pier vertäute. »Damit war doch wohl zu rechnen?«, fragte sie. »Viele Menschen sind durch das Feuer obdachlos geworden, und man kann einer Familie keinen Vorwurf daraus machen, dass sie sich ein Dach über dem Kopf sucht.«
»Nur dass es sich nicht um eine Familie handelt«, versetzte die Schwester sachlich. »Es ist ein Dämon, ein Feuerdämon, heißt es, der die Gestalt einer Eidechse angenommen hat.«
Feyra trat einen Schritt zurück, musterte die Nonne forschend und versuchte zu ergründen, ob sie sich einen Scherz mit ihr erlaubte, aber Schwester Benedettas Miene war todernst. Sie hob die breiten Schultern. Dämonen gehörten zu ihrem Alltag.
»Wir werden das Haus im Auge behalten, warten und beten und Euch benachrichtigen, sowie der Eidechsendämon aus dem Haus vertrieben worden ist. Aber die Triannis sollten noch wenigstens eine Woche hierbleiben.«
Feyra nahm die Nachricht, dass sich die Abreise ihrer Freunde verzögerte, mit Erleichterung, aber auch einer Spur heimlicher Enttäuschung auf. Sie überlegte manchmal, was geschehen würde, wenn sie und Annibale allein auf der Insel waren.
In dieser Nacht träumte sie von ihm, so intensiv, dass sie meinte, seine Hitze und sein Gewicht auf ihrem Körper zu spüren. Als sie erwachte, rang sie nach Atem, als habe ihr jemand eine Hand auf den Mund gelegt und ihr die Luft abgeschnürt. Die Scham strömte zusammen mit Schweiß aus ihr heraus. Feyra stand auf und schlich nach unten, wo das Feuer noch immer brannte. Die Bibel, die die Badessa ihr gegeben hatte, stand auf dem Kaminsims. Sie wollte das Buch nicht im Haus haben, brachte es aber nicht über sich, ein gut gemeintes Geschenk zu verbrennen.
In Konstantinopel war der Name Gottes heilig. Wurde er auf Papier geschrieben, so wurde selbst der kleinste Fetzen zu einer Kostbarkeit. Weil die Leute solche Papierstücke bei sich trugen, wurden diese oft auf dem Boden gefunden, und die Bürger Konstantinopels hoben sie auf und steckten sie in die Mauern. Einige der belebteren Straßen waren vom Namen Gottes förmlich durchdrungen. Feyra wollte die Bibel nicht verbrennen. Obwohl der dort genannte Gott nicht der ihre war, fürchtete sie sich vor seiner Rache.
Da ihr plötzlich zu heiß war, trat sie so, wie sie war, in ihrem langen Hemd in die Nacht hinaus. Der Boden war kalt unter ihren Füßen, und sie spürte, wie ein willkommener Schauer über ihre brennende Haut lief. Ein runder Frühlingsmond schien fast so hell wie die Sonne, Sterne funkelten am Firmament, und sie konnte jeden silbrigen Grashalm so klar und deutlich erkennen, als wäre es Tag.
Sie ging über den Rasen zum Tezon. Der Saum ihres Hemdes schleifte über das taufeuchte Gras und sog sich voll. In dem leeren Krankenhaus erleuchtete der Mond das Atrium des gewölbeähnlichen Raums, und die Geister derer, die sie dort behandelt hatte, flüchteten in die Schatten. Rings um die Tür konnte sie die an die Wand gekritzelten graffiti sehen, die sie zuvor jeden Tag gesehen hatte. Sie schienen im Mondschein schwach zu glühen, und ihr Blick fiel wieder auf das osmanische Schiff und die Kalligrafie, die ihr einst ein solcher Trost gewesen war.
Die Zeichnungen sprachen von einer vergangenen Toleranz gegenüber den vielen Menschen, die hierher gekommen waren, um Handel zu treiben, von einer Beziehung zum beiderseitigen Vorteil, vom gegenseitigen Geben und Nehmen. Dieses frühere Venedig war ein Schmelztiegel von Nationalitäten, Rassen und Religionen gewesen, der so viele Farben aufwies wie ein Kristallprisma, und sie konnte nur hoffen, dass Venedig wieder so werden würde, wenn die Pest abebbte. Sie konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass der Sultan zusammen mit den vier
Weitere Kostenlose Bücher