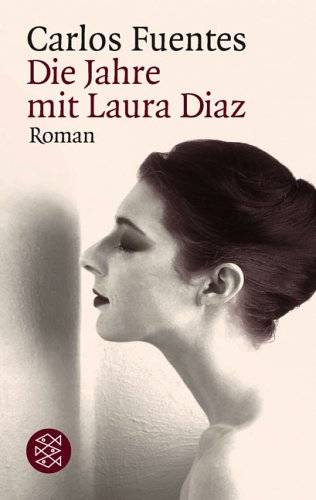![Die Jahre mit Laura Diaz]()
Die Jahre mit Laura Diaz
fünf Uhr nachmittags würden sie mit dem orangeroten Schulbus heimkommen. Die Liste der in der Schule benötigten Sachen war vollständig eingekauft, die Schweizer Bleistifte der Firma Eberhardt, die Schreibfedern, die keine Marke und keine Nationalität hatten und in die Tintenfässer auf dem Pult getaucht werden sollten, die karierten Hefte für Arithmetik, die linierten für die Aufsätze, die Nationalgeschichte des Pfaffenfressers Teja Zabre, als sollten damit der Mathematikunterricht des Maristenbruders Anfossi, die Englischlektionen, die spanische Grammatik und die grünen Lehrbücher für Weltgeschichte der Franzosen Malet und Isaac aufgewogen werden. Die Ranzen. Die Pasteten aus Bohnen, Sardinen und Chili zwischen zwei Weißbrothälften, die übliche Orange und das Verbot, Süßigkeiten zu kaufen, die nur Löcher in die Zähne fraßen.
Laura wollte den Tag mit ihren neuen Beschäftigungen ausfüllen. Die Nacht belauerte sie, der Morgen klopfte an ihre Tür, und dann konnte sie nicht sagen: Die Nacht gehört uns.
Sie machte sich selbst Vorwürfe: »Ich darf nicht den besten Teil meines Wesens dazu verurteilen, im Grab der Erinnerungen zu ruhen.« Doch die wortlose nächtliche Bitte ihres Manns: Wie wenig verlange ich von dir. Laß mich spüren, daß du mich brauchst, konnte Lauras immer wiederkehrende Mißstimmung in den einsamen Stunden nicht besänftigen, wenn die Kinder in der Schule und Juan Francisco in der Gewerkschaft war. »Wie leicht wäre das Leben ohne Mann und ohne Kinder.« Sie kehrte nach Coyoacân zurück, als auch die Riveras wieder da waren. Ihnen eilten die schwarzen Wolken eines neuen Skandals voraus, zu dem es in New York gekommen war, wo Diego die Gesichter von Marx und Lenin in das Wandgemälde des Rockefeller Center aufgenommen hatte, was schließlich zum Ersuchen Nelson Rockefellers führte, Diego solle das Bild des sowjetischen Führers entfernen, was der natürlich abgelehnt und statt dessen angeboten hatte, als Ausgleich für den Kopf Lenins den Lincolns hinzuzufügen. Zwölf bewaffnete Polizisten befahlen dem Maler schließlich, mit dem Malen aufzuhören, und dafür übergaben sie ihm einen Scheck über vierzehntausend Dollar. (»Kommunistischer Maler bereichert sich mit kapitalistischen Dollars.«) Die Gewerkschaften bemühten sich, das Wandgemälde zu retten, aber die Rockefellers ordneten an, es mit Meißeln abzuschlagen, und warfen es in den Müll. »Wie gut«, sagte die Kommunistische Partei der Vereinigten Staaten, denn das Fresko Riveras sei »konterrevolutionär«. Diego und Frida fuhren nach Mexiko zurück, er war ziemlich traurig, und sie schimpften hemmungslos auf das »Gringoland«. Nun waren sie wieder da, doch für Laura gab es keinen richtigen Platz mehr: Diego wollte sich mit einem weiteren Wandgemälde, diesmal einem für die New School, an den Gringos rächen, Frida hatte ein leiderfülltes Selbstbildnis mit einem leeren Kleid gemalt, einer Tracht aus Tehuantepec, die inmitten von seelenlosen Wolkenkratzern hing, direkt an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. »Hallo, Laurita, wie geht's? Komm, wann du willst, wir sehen uns dann bald…«
Ein Leben ohne Mann und Kinder. Nur eine Mißstimmung, wie eine Fliege, die sich hartnäckig immer wieder auf unsere Nasenspitze setzt, die wir verscheuchen und die beharrlich wiederkommt, denn Laura wußte ja längst, wie das Leben ohne Juan Francisco, ohne ihre Kinder Danton und den jungen Santiago war, und als sie vor der Wahl stand, hatte sie nichts Größeres und Besseres gefunden, als sich wieder für ein Leben als Gattin und Familienmutter zu entscheiden – wenn nur Juan Francisco nicht so offensichtlich die Überzeugung, daß seine Frau ihn verurteilte, mit der Pflicht vermengte, sie zu lieben. Ihr Mann suchte sich einen unveränderlichen Ankerplatz. Einerseits reizte sie die übermäßige Verehrung, die er ihr nun zeigte, als hätte er sich entschieden, damit die Fehler der Vergangenheit wiedergutzumachen; es war seine Art, um Verzeihung zu bitten, und doch führte es zu einem ganz anderen Ergebnis: »Ich hasse ihn nicht, er wird mir lästig, er liebt mich zu sehr, ein Mann soll uns nicht zu sehr lieben. Was Juan Francisco fehlt, ist ein vernünftiges Gleichgewicht, er muß lernen, daß es eine Grenze gibt zwischen dem Bedürfnis einer Frau, geliebt zu werden, und dem Verdacht, daß sie nicht wirklich dermaßen geliebt wird.«
Juan Francisco mit seinen Liebkosungen, Aufmerksamkeiten und der
Weitere Kostenlose Bücher