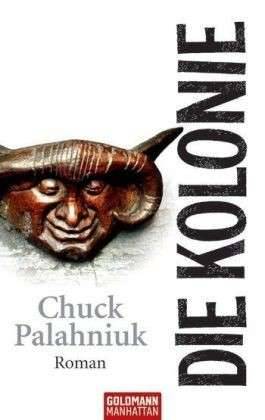![Die Kolonie]()
Die Kolonie
ihren Lippenstift mit Lippenstift. »Sie können einen nicht korrigieren.«
Trotzdem, eine gute Geschichte verlangt: keine Heizung. Der langsame Hungertod verlangt: kein Frühstück. Verdreckte Kleidung. Wir mögen ja nicht so intellektuell und klug wie Lord Byron und Mary Shelley sein, aber dafür machen wir so manchen Scheiß mit, wenn es nur unserer Geschichte dient.
Mr. Whittier, unser altes, totes Monster.
Mrs. Clark, unser neues Monster.
»Der heutige Tag«, sagt der Kuppler, »wird sehr, sehr lang werden.«
Und Schwester Vigilante hebt eine Hand, ihre Armbanduhr leuchtet radiumgrün im fast dunklen Flur. Schwester Vigilante schüttelt die Uhr, dass sie aufblitzt, und sagt: »Der heutige Tag wird so lange, wie ich es sage...«
Zu Mrs. Clark sagt sie: »Jetzt zeigen Sie mir, wie man das verdammte Licht anmacht.«
Und Missing Link sorgt dafür, dass einer ihrer Pantoffeln auf den Boden fällt.
Clark und die Schwester tappen durch die Finsternis davon, tasten sich an den feuchten Korridorwänden entlang in Richtung Bühne, auf der grau das Geisterlicht glimmt.
Mr. Whittier, unser neues Gespenst.
Sogar Sankt Prolaps' Magen knurrt.
Miss America sagt, dass manche Frauen Essig trinken, um ihren Magen zu verkleinern. So sehr kann nagender Hunger schmerzen.
»Erzählt mir eine Geschichte«, sagt Mutter Natur. »Irgendwer«, sagt sie, »soll mir eine Geschichte erzählen, auf dass ich nie, nie mehr im Leben etwas essen will...«
Direktorin Dementi drückte ihre Katze an sich und sagt: »Eine Geschichte mag dir ja vielleicht den Appetit verderben, aber Cora hat immer noch Hunger.«
Und Miss America sagt: »Sag der Katze, in ein paar Tagen wird sie selber gefressen.« Schon sehen ihre rosa Spandextitten größer aus.
Und Sankt Prolaps sagt: »Bitte, kann bitte irgendwer meine Gedanken von meinem Magen ablenken.« Zum ersten Mal ohne was zu essen im Mund, klingt seine Stimme ganz anders, glatt und trocken.
Der Gestank ist dick wie Nebel. Dieser Geruch, den niemand einatmen will.
Und auf dem Weg zur Bühne, auf das Geisterlicht zu, sagt der Herzog der Vandalen: »Bevor ich mein erstes Gemälde verkauft habe...« Er sieht sich um, ob wir ihm auch folgen, und sagt: »... war ich das Gegenteil von einem Kunstdieb..,«
Und Raum für Raum beginnt die Sonne aufzugehen.
Und im Kopf notieren wir alle: Das Gegenteil von einem Kunstdieb ...
Zu vermieten
Ein Gedicht über den Herzog der Vandalen
»Niemand nennt Michelangelo den Arsch des Vatikans«,
sagt der Herzog der Vandalen,
bloß weil er Papst Julius um Arbeit gebeten hat.
Der Herzog auf der Bühne, sein kratziger Kiefer, eine Bürste
mit bleichen Borsten,
geht hin und her, knetet und knirscht auf einem
Nikotinkaugummi herum.
Graues Sweatshirt und Leinenhose, alles besprenkelt mit getrockneten
Rosinen aus roter, dunkelroter,
gelber, blauer und grüner, brauner, schwarzer und weißer Farbe.
Sein Haar überstürzt sich hinter ihm, ein Gewirr aus Drähten,
dunkel von Pomade
und bestäubt mit hartnäckigen Schuppen.
Auf der Bühne, statt eines Scheinwerfers, ein Filmausschnitt:
eine Diashow aus Porträts und Allegorien, Stillleben und
Landschaften.
Diese alte Kunst benutzt sein Gesicht, seine Brust, seine
Strumpffüße in Sandalen
als Galerie.
Der Herzog der Vandalen, er sagt: »Niemand nennt Mozart eine
Kulturhure«
weil er für den Erzbischof von Salzburg gearbeitet hat.
Danach, später schrieb er die Zauberflöte,
schrieb Eine kleine Nachtmusik,
spärlich bezahlt von Giuseppe Bridi und seiner
florierenden Seidenindustrie. Und niemand nennt Leonardo daVinci einen Verräter,
ein Werkzeug,
weil er für Gold von Papst Leo X. und Lorenzo de Medici
Farbe verspritzt hat.
»Nein«, sagt der Herzog. »Wir betrachten Das letzte Abendmahl und die
Mona Lisa
und haben keine Ahnung, wer dafür gezahlt hat.«
Was zählt, sagt er, ist das, was der Künstler hinterlässt,
das Kunstwerk.
Nicht, wie man die Miete bezahlt.
Ehrgeiz
Eine Erzählung vom Herzog der Vandalen
Ein Richter sprach von »böswilliger Sachbeschädigung«. Ein anderer Richter sprach von »Zerstörung öffentlichen Eigentums«.
Nachdem ihn im New Yorker Museum of Modern Art die Wachen überwältigt hatten, kam die ultimative Beleidigung von einem Richter, der die Anklage auf »Verunreinigung« reduzierte. Nach der Sache im Getty Museum in Los Angeles bezeichnete der Richter das, was Terry Fletcher angerichtet hatte, als »Graffiti«.
Ob im Getty, im Frick oder in der
Weitere Kostenlose Bücher