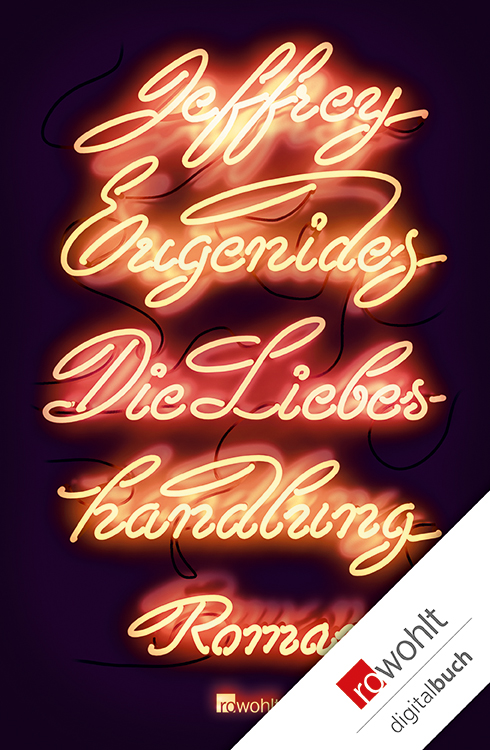![Die Liebeshandlung]()
Die Liebeshandlung
musste – ein ebenso mädchenhaftes und großmütterliches Gesicht und so undefinierbar wie die Stimme mit dem seltsamen osteuropäischen Akzent, die aus einem lippenlosen Mund kam –, immer wenn Mutter Teresa sprach, zitierte sie Matthäus 25,40: «Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.» Das war die Bibelstelle, auf die sie ihre Arbeit gründete, Ausdruck eines mystischen Glaubens und zugleich praktische Anleitung für karitative Handlungen. Die kaputten, erkrankten Leiber im Heim für sterbende Notleidende waren der Leib Christi, die jedem innewohnende Gottheit. Jeder hier sollte diese Bibelstelle
wörtlich
nehmen. So fest und aufrichtig an sie glauben, dass es durch irgendeine Seelenalchemie geschah: Man blickte in die Augen eines Sterbenden und sah Jesus zurückblicken.
Das war Mitchell nicht widerfahren. Er rechnete auchnicht damit, dass es ihm widerfahren würde, aber am Ende seiner zweiten Woche war ihm unangenehm bewusstgeworden, dass er im Heim nur die simpelsten, anspruchslosesten Aufgaben verrichtete.
Zum Beispiel hatte er noch nie jemanden gebadet. Patienten zu baden war der wichtigste Dienst, den die ausländischen Freiwilligen leisteten. Sven und Ellen, die zu Hause in Minnesota einen Landschaftsbaubetrieb hatten, arbeiteten sich jeden Morgen durch die Reihe der Betten und halfen Männern zu den Waschräumen auf der anderen Seite des Hauses. Waren die Männer zu schwach oder zu krank, um zu gehen, holte Sven den Bienenzüchter oder den anglikanischen Pastor, damit sie ihm halfen, die Pritsche zu tragen. Während Mitchell Kopfmassagen verabreichte, beobachtete er, wie Leute, die in keiner Weise außergewöhnlich waren, die außergewöhnliche Arbeit verrichteten, diese kranken und sterbenden Männer des Heims erst zu säubern und abzutrocknen und dann mit nassem Haar, die spindeldürren Körper in frische Tücher gewickelt, in ihre Betten zurückzubringen. Tag um Tag fand er Mittel und Wege, nicht dabei zu helfen. Er hatte Angst davor, die Männer zu baden. Er fürchtete sich vor dem Anblick ihrer nackten Körper, fürchtete sich vor den Krankheiten und Wunden unter ihren Gewändern, und er fürchtete sich vor ihren körperlichen Ausscheidungen, davor, mit seinen Händen ihren Urin oder Kot zu berühren.
Was Mutter Teresa anging, so hatte Mitchell sie erst einmal gesehen. Sie arbeitete nicht mehr täglich im Heim. Sie hatte Hospize und Waisenhäuser sowohl in ganz Indien als auch in anderen Ländern und war den Großteil des Tages mit der Leitung der gesamten Organisation beschäftigt. Mitchell hatte gehört, die beste Möglichkeit, Mutter Teresa zusehen, sei ein Besuch der Messe im Mutterhaus, und so verließ er eines Morgens vor Sonnenaufgang die Heilsarmee und ging durch die stillen, dunklen Straßen zum Kloster in der A. J. C. Bose Road. Als er die von Kerzen beleuchtete Kapelle betrat, bemühte er sich, nicht zu zeigen, wie aufgeregt er war – er fühlte sich wie ein Fan mit einem Backstagepass. Er gesellte sich zu einer kleinen Gruppe von Ausländern, die sich bereits versammelt hatten. Vor ihnen, auf dem Boden, beteten andere Nonnen schon, nicht nur auf Knien, sondern niedergeworfen vor dem Altar.
Hektisches Köpfeverrenken bei den Freiwilligen wies ihn darauf hin, dass Mutter Teresa die Kapelle betreten hatte. Sie sah unfassbar winzig aus, nicht größer als eine Zwölfjährige. Sie ging weiter bis in die Mitte der Kapelle, kniete nieder und berührte mit der Stirn den Boden. Alles, was Mitchell sehen konnte, waren ihre nackten Fußsohlen. Sie waren rissig und gelb – die Füße einer alten Frau –, doch schienen sie allerhöchste Bedeutung zu haben.
An einem Freitagmorgen in seiner dritten Woche in der Stadt stand Mitchell auf, putzte sich mit jodhaltigem Wasser die Zähne, schluckte eine Chloroquintablette (zur Vorbeugung gegen Malaria), und nachdem er sich Leitungswasser ins Gesicht und auf seinen fast haarlosen Kopf gespritzt hatte, ging er zum Frühstück. Mike gesellte sich zu ihm, aß aber nichts (da ihn sein Magen plagte). Rüdiger kam mit einem Buch an den Tisch. Mitchell frühstückte schnell zu Ende, ging wieder hinunter in den Hof und auf die Sudder Street hinaus.
Es war Anfang Januar und kälter, als Mitchell es von Indien erwartet hatte. Als er an den Rikschas draußen vor dem Tor vorbeilief, riefen ihm die Fahrer etwas zu, doch entsetzt von dem Gedanken, Menschen als Zugtiere zu benutzen,winkte er ab.
Weitere Kostenlose Bücher