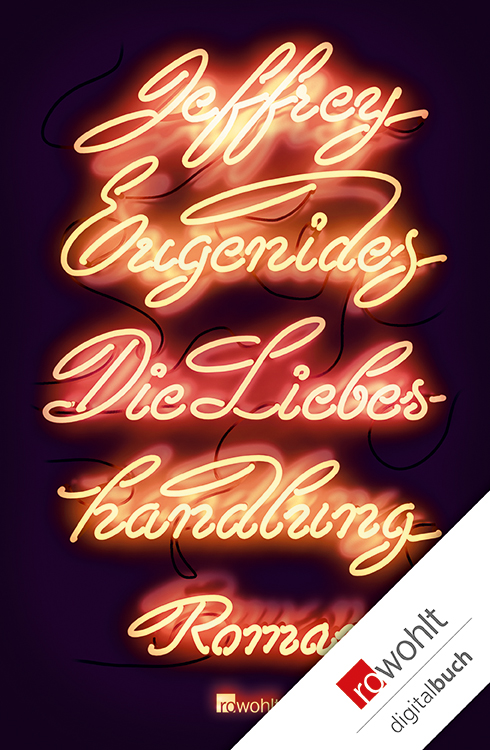![Die Liebeshandlung]()
Die Liebeshandlung
An der Jawaharlal Nehru Road angekommen, arbeitete er sich durch den Verkehr. Als dann zehn Minuten später sein Bus kam, gefährlich geneigt unter der Last der von den Türen hängenden Passagiere, hatte die Wintersonne den Dunst weggebrannt, und der Tag heizte sich auf.
Das Viertel Kalighat im Süden der Stadt hatte seinen Namen vom Kalitempel in seiner Mitte. Der Tempel sah nach nichts aus, einer örtlichen Filiale mit dem Hauptsitz anderswo, aber die Straßen ringsum waren hektisch und farbig. Verkäufer verhökerten Kultrequisiten – Blumengirlanden, Töpfchen mit Ghee, grelle Poster der Göttin Kali mit herausgestreckter Zunge – an Pilger, die in den Tempel und wieder hinaus strömten. Unmittelbar hinter dem Tempel, mit dem es eine Wand gemeinsam hatte – weshalb die Freiwilligen es «Kalighat» nannten –, lag das Heim.
Mitchell bahnte sich seinen Weg durch das Menschengedränge zu der unauffälligen Tür und ging die Treppe hinunter in den halb unterirdischen Raum. Der schlauchartige Saal war halbdunkel, das einzige Licht drang durch Fenster auf Straßenhöhe oben in der Außenwand herein, vor denen man die Beine der Vorbeigehenden sah. Mitchell wartete, bis seine Augen sich angepasst hatten. Langsam, als würden sie aus einer Unterwelt in ihren Betten herbeigerollt, tauchten die mitgenommenen Körper in drei schemenhaften Reihen auf. Jetzt, wo er etwas erkennen konnte, ging Mitchell durch die Station nach hinten in den Vorratsraum. Dort traf er die irische Ärztin an, die gerade ein Blatt mit handgeschriebenen Notizen studierte. Die Brille war ihr die Nase heruntergerutscht, und sie musste den Kopf nach hinten kippen, um sehen zu können, wer hereingekommen war.
«Ach, da bist du ja», sagte sie. «Ich bin gleich damit fertig.»
Sie meinte den Medikamentenwagen. Sie stand davor und steckte Tabletten in nummerierte Fächer obendrauf. Hinter ihr lagerten Schachteln mit Medikamentenvorräten bis unter die Decke. Selbst Mitchell, der nichts über Arzneimittel wusste, fiel auf, dass es da ein Verteilungsproblem gab: Von einigen Dingen (Gazeverbänden etwa und, aus unerfindlichen Gründen, Mundwasser) war viel zu viel da, dafür herrschte Knappheit an Breitbandantibiotika wie Tetrazyklin. Einige Organisationen verschickten Arzneimittel erst Tage vor dem Verfallsdatum und verlangten dafür noch Steuerermäßigungen. Viele Medikamente dienten der Behandlung von vornehmlich in den reichen Ländern verbreiteten Krankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes, halfen aber nicht gegen häufige indische Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria oder Trachom. Es gab nur wenige Schmerzmittel – kein Morphin, keine Opioide. Nur Paracetamol aus Deutschland, Aspirin aus den Niederlanden und Hustenstiller aus Liechtenstein.
«Sieh an», sagte die Ärztin nach einem flüchtigen Blick auf ein grünes Fläschchen. «Vitamin E. Gut für die Haut und die Libido. Genau das, was die Herrschaften hier brauchen.»
Sie warf das Fläschchen in den Müll und zeigte auf den Wagen. «Jetzt bist du dran», sagte sie.
Mitchell bugsierte den Wagen aus dem Vorratsraum und begann an der unteren Bettenreihe. Die Medikamentenausgabe war eine Aufgabe, die er gern erledigte. Es war relativ leichte Arbeit, intim und trotzdem oberflächlich. Er wusste nicht, wogegen die Tabletten waren. Er musste nur dafür sorgen, dass die Richtigen sie bekamen. Manchen Männern ging es gut genug, dass sie sich aufsetzen und die Tabletten selbst einnehmen konnten. Anderen musste er den Kopf stützen und ihnen beim Trinken helfen. Männer, die
paan
kauten, hatten Münder wie klaffende blutige Wunden. Denältesten fehlten meistens sämtliche Zähne. Einer nach dem anderen öffneten sie den Mund und ließen sich von Mitchell Tabletten auf die Zunge legen.
Für den Mann in Bett 24 gab es keine Tablette. Mitchell sah schnell, warum nicht. Ein verfärbter Verband bedeckte sein halbes Gesicht. Die Mullbinde hatte sich tief ins Fleisch eingeschnitten, als haftete sie direkt am Schädelknochen darunter. Die Augen des Mannes waren geschlossen, aber sein Mund war zu einer Grimasse geöffnet. Während Mitchell all das in sich aufnahm, erklang hinter ihm eine tiefe Stimme.
«Willkommen in Indien.»
Es war der Bienenzüchter mit frischer Gaze, Heftpflaster und einer Schere in der Hand.
«Staphylokokkeninfektion», sagte er, auf den bandagierten Mann deutend. «Hat sich vermutlich beim Rasieren verletzt. Oder irgendwas ähnlich Harmloses. Dann geht er in den Fluss,
Weitere Kostenlose Bücher