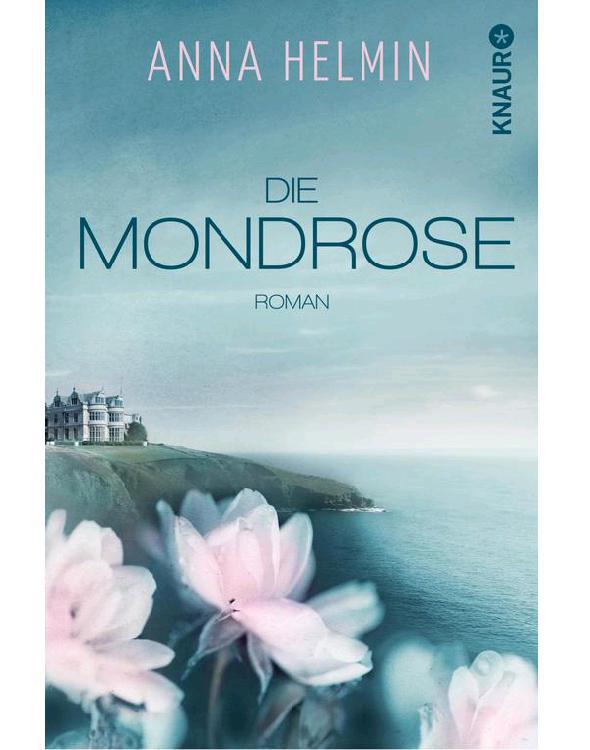![Die Mondrose]()
Die Mondrose
recht, davon noch etwas abzuzweigen. Ich kann von Glück sagen, dass für die Mitgift meiner Töchter gesorgt ist.«
Der Detektiv nickte. Hyperion legte das Geld für die Getränke auf den Tisch, und gemeinsam verließen sie das Lokal. Es war einer jener schönen Oktoberabende, die weich und melancholisch noch einen Abschiedsgruß vom Sommer in sich trugen. »Ich habe immer gehofft, Sie würden eines Tages darüber hinwegkommen«, sagte Wolfe. »Sie sind ein Mann von so außergewöhnlichen Talenten – ich habe Ihre Arbeiten zur Cholera und zur Kaiserschnittgeburt gelesen und bei mir gedacht: Hier ist einmal ein Mann, der seinen Platz im Leben gefunden hat. Sie haben vier wohlgeratene Töchter, und Ihre Frau – nun, sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, nicht wahr? Aber Sie nennen sie ja nie Ihre Frau. Wenn Sie von Ihrer Frau sprechen, meinen Sie immer Daphne.«
»Ja«, erwiderte Hyperion. »Und ich werde nie darüber hinwegkommen. Es ist seltsam, das zu sagen, aber ich werde Sie vermissen. Haben Sie Dank für alles, was Sie für mich getan haben.«
»Ich habe ja nichts für Sie getan«, bemerkte Wolfe bedauernd. »Nicht das zumindest, was Sie sich so sehr erhofft haben. Ich werde Sie auch vermissen, Doktor. Was ich Ihnen zum Abschied wünschen soll, weiß ich nicht.«
»Dass ich irgendwann erfahre, was mit ihnen geschehen ist«, sagte Hyperion. »Bitte wünschen Sie mir das. Mein Sohn Louis, dessen winzige Hand ich in meiner immer noch zu spüren glaube, muss inzwischen ein Mann von zwanzig Jahren sein, und das Haar des süßen Mädchens, das ich geheiratet habe, ergraut vielleicht schon so wie meines. Wissen Sie, wie unvorstellbar das ist, wie absurd es alles macht? Erst recht einen Ball in der Admiralität, bei dem man darüber palavert, ob der Champagner zu warm und die Gurkensandwichs dünn genug geschnitten sind.« Er reichte Wolfe die Hand. »Es war nicht recht, danach noch einmal Kinder zu haben, eine Frau, ein Leben. Verstehen Sie das?«
Wolfe schlug ein und nickte. »Ich hoffe nur, Ihre Töchter verstehen es auch«, sagte er.
Für gewöhnlich fühlte Esther sich in prunkvollen Ballsälen verloren und fehl am Platz. Heute Abend aber schienen das verschwenderische Licht der Kronleuchter, der Glanz des Kristalls und das Schimmern der Roben den rechten Rahmen für ihre Stimmung abzugeben, und den schwungvollen Walzer, den die Kapelle spielte, hätte sie am liebsten mitgesungen. Esther war glücklich. Sie tanzte mit Noras langweiligem Vetter Philip und sogar mit Andrew Ternan, ohne sich zu beklagen, und ehe sie sich erschöpft zwischen Georgia und Phoebe auf einen Stuhl plumpsen ließ, versprach sie dem Hotelerben einen weiteren Tanz am Ende des Balls.
»Sie machen mich sehr froh«, sagte Ternan, ehe er von dannen zog. Es sei dir gegönnt, dachte Esther. Jemand, dem in einer einzigen Woche so viel Glück widerfuhr wie ihr, hatte allen Grund, zu anderen großzügig zu sein.
Zuerst hatte sie die Ergebnisse ihrer Jahresexamen erhalten, die sämtlich besser ausgefallen waren als erwartet. Ihrem Ziel, dem Abschluss, der sie zum Studium berechtigte, kam sie damit einen mächtigen Schritt näher. Nur noch ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr. Vor Aufregung hätte Esther sofort wieder aufspringen und sich frei von männlicher Führung zur Musik bewegen mögen, bis ihr schwindlig wurde. Ihre Eltern würden ihr keine Steine in den Weg legen, dessen war sie gewiss. Ihren Vater interessierte nur seine Arbeit, und Mildred würde froh sein, sie loszuwerden, solange sie für die Überfahrt selbst bezahlte.
Das Geld dazu – und das war der Höhepunkt des Glücks – würde sie tatsächlich zusammenbekommen. Mit dem bisschen Schreibarbeit, die Lydia ihr vermittelt hatte, war kaum etwas zu verdienen gewesen, aber jetzt hatte sie eine richtige Stellung, und dazu an genau dem Ort, an dem sie Tag und Nacht sein wollte. Im Spital!
Ihr Vater sah sie nicht gern dort. Unzählige Male hatte sie versucht ihm ihre Hilfe anzubieten – ohne Bezahlung, nur um von ihm zu lernen und Erlerntes anzuwenden. Es gab kein medizinisches Lehrbuch im Haus, das sie nicht gelesen hatte, es gab keine Schnitt- oder Nahttechnik, die sie nicht an ihren Puppen geübt hatte. Ihr Vater hatte sie dennoch rundheraus abgewiesen. Das Spital sei kein Aufenthaltsort, den er für seine Tochter verantworten könne, behauptete er. In Wahrheit, so wusste Esther, hatte er sie schlicht nicht gern um sich. Er hatte keine von ihnen gern um sich. Das einzige Kind, das
Weitere Kostenlose Bücher