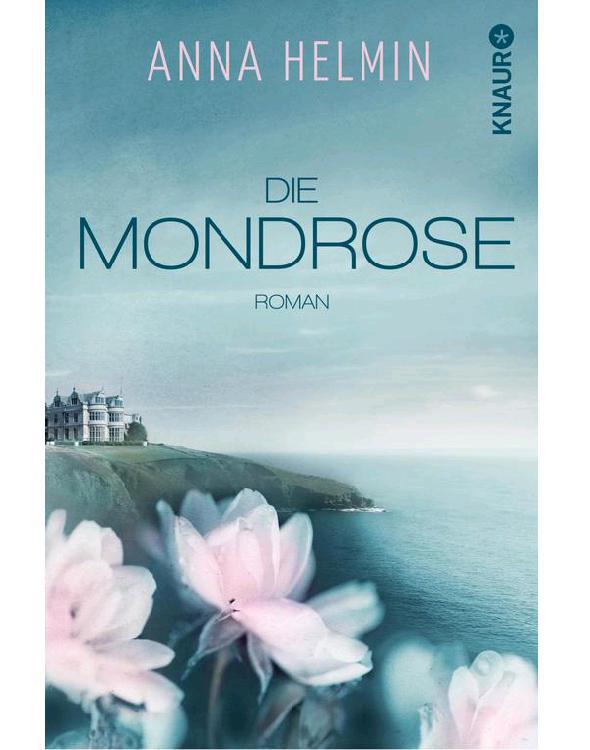![Die Mondrose]()
Die Mondrose
möglich? Hatte er nicht Max nach Hause geschickt und das Gartentor verschlossen? Jemand musste über den Zaun gestiegen sein. Schwerfällig machte Hyperion sich auf den Weg durch Salon und Empfangshalle. Das Klopfen riss nicht ab. Wer auch immer dort im Schneeregen stand, hieb seine Faust ohne Unterlass ans Holz. Hastig entriegelte er die Schlösser und riss einen der Türflügel zurück. Der Mann, der gegen ihn prallte, triefte aus jeder Pore.
»Miss Daphne«, stieß der Besucher atemlos aus, »sie liegt auf den Tod. Müssen sofort kommen, Herr Doktor. Ich bitte Sie.«
Es war Victor, der Deutsche aus Hectors Pension. Aus dem Haar rann ihm Wasser, und mit flehenden Augen sah er Hyperion an. Im gedämpften Licht der Halle entdeckte er, dass der große Mann Augen, Haar und Haut von nahezu derselben Farbe hatte, einem wie vergoldeten Braun. Ohne Federlesens griff er nach Schal und Mantel. Erst als sie schon die vereisten Stufen hinuntereilten, fragte er: »Wer ist Miss Daphne?«
»Miss Mildreds Schwester«, erwiderte Victor in einem Ton, als spräche er von einer Schwester der Königin.
Wie vermutet, war er über den Zaun gestiegen, was er jetzt von neuem anging, ohne auf Hyperion mit dem Schlüssel zu warten. Verblüffend elegant zog er sein Gewicht in die Höhe, überwand die geschmiedeten Spitzen und sprang auf der anderen Seite zu Boden. Sogleich rannte er weiter, wandte nur kurz den Kopf, um zu prüfen, ob Hyperion ihm folgte. Der war nach der ersten Biegung außer Atem, der Deutsche hingegen lief mit unverminderter Kraft.
Die Gassen der Gewürzinsel lagen in Finsternis, und wo sonst Lärm tobte, herrschte Schweigen. Nur der Gestank verriet, dass sie am Ziel waren. Hyperion keuchte und hielt sich die schmerzende Seite. Willenlos ließ er sich von Victor in den Hof und dann durch einen Türspalt zwängen. Dahinter entzündete sein Begleiter eine Lampe, so dass man endlich die Hand vor Augen sah. Die Luft war wie Leim, und es roch, als hätte auf den Stufen jemand uriniert. Dennoch musste Hyperion lächeln. Er war heute schon einmal hier gewesen, weil er sie wiedersehen wollte, die streitbare Mildred mit dem wilden Haar. Vielleicht, weil er in ihr zu spüren glaubte, was ihm fehlte – Kampfgeist und Lebenslust. Vielleicht, weil sie tat, was sonst niemandem gelang – sie amüsierte ihn.
Ihm voran jagte Victor die Stufen hinauf. In einem der Schlafsäle war Hyperion nie gewesen, sooft ihn Vernon auch beschworen hatte, er solle die Augen davor nicht verschließen. Bettgestell reihte sich an Bettgestell, und auf jeder Matratze wälzten sich Leiber. Der Gestank war unsäglich. Hier kann sie nicht bleiben, durchzuckte es ihn. Im selben Augenblick entdeckte er sie. Von einem Bett in der Ecke sprang sie auf und stürmte auf ihn zu. Er fing sie, genoss die vor Leben bebende Nähe. Dann befreite sie sich und schrie: »Helfen Sie ihr! So machen Sie doch!« Erst jetzt sah Hyperion, dass ihr Gesicht nass vor Tränen war.
Sie lief voraus. Am Fußende des Bettes stand Victor neben dem verwachsenen Jungen. Der Schein der Kerzen fiel auf die Kranke, deren Leib unter einem Berg von Lumpen begraben war. Zur Diagnose genügte ein Blick auf das Gesicht und den entblößten Hals. Fleckfieber. Die Seuche, die man für eine Spielart des Typhus gehalten hatte, die in Wahrheit jedoch eine Mörderin eigenen Kalibers war. Hyperion hatte etliche daran verrecken sehen, in den Lazaretten der Krim wie im Spital, doch von all den sterbenden Gesichtern stand ihm nur eines vor Augen – das Gesicht seiner Mutter. Sie hatte vor ihm gelegen wie die junge Frau, wenn auch in schneeweißen Laken. Saurer Schweiß hatte den Duft ihres Parfüms zerstört, und ihre Finger zerfetzten ihr Spitzenhemd. So hatte er sie zum letzten Mal gesehen, ihr schönes Gesicht von Flecken entstellt wie das der Fremden.
Er setzte sich auf den Bettrand und beugte sich über sie, um zu ertasten, ob noch ein Pulsschlag, ein Funken Leben spürbar war. Nicht nur die Krankheit verband das Mädchen mit seiner Mutter, sondern ebenso das helle Haar und die Lippen, die zart und unversehrt wirkten. So sehr, dass er glaubte sie lächeln zu sehen – jenes Lächeln, nach dem er sich ohne Ende sehnte. Er war als Arzt hier, er musste handeln, der armen Mildred begreiflich machen, dass ihre Schwester nicht zu retten war. Allein, er wollte nicht handeln, nicht Stärke beweisen, nicht noch einmal die Stimme seiner Großmutter hören und das Klatschen, mit dem sie ihm ins Gesicht
Weitere Kostenlose Bücher