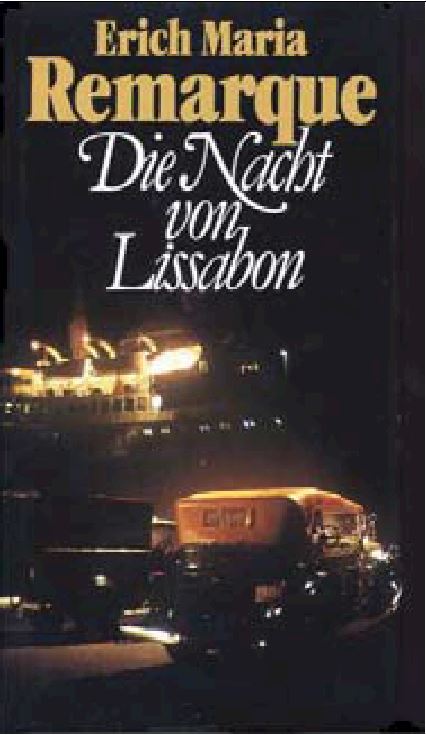![Die Nacht Von Lissabon]()
Die Nacht Von Lissabon
der
gerade noch der letzte zerrinnende Nebel eines Traumes
schwebte, an den man sich schon nicht mehr erinnern
konnte. Ich wußte damals noch nicht, woher das kam - ich nahm es als ein unvermutetes Geschenk, als wäre mir erlaubt worden, ein Stück schlechtgelebten Daseins zu wiederholen und es in volles Leben zu verwandeln. Aus einem Maulwurf, der sich ohne Paß unter den Grenzen durchwühlte, wurde ich zu einem Vogel, der keine Grenzen kannte.
Eines Morgens, als ich Helen abholen wollte, traf ich einen Herrn Krause bei ihr, den sie als jemand vom deutschen Konsulat vorstellte. Sie sprach mich, als ich eintrat, französisch an und nannte mich Monsieur Lenoir. Krause mißverstand sie und fragte mich in schlechtem Französisch, ob ich der Sohn des berühmten Malers sei.
Helen lachte. ›Herr Lenoir ist Genfer‹, erklärte sie. ›Aber er spricht auch Deutsch. Mit Renoir ist er nur durch große Bewunderung verwandt.‹
›Sie lieben impressionistische Bilder?‹ fragte Krause
›Er hat selbst eine Sammlung‹, sagte Helen.
›Ich habe ein paar Zeichnungen‹, erwiderte ich. Die Erbschaft des toten Schwarz als Sammlung zu erwähnen, schien mir eine von Helens neuen Kapriolen. Da aber eine ihrer Kapriolen mich vor dem Konzentrationslager bewahrt hatte, spielte ich mit.
›Kennen Sie die Sammlung Oskar Reinharts in Winterthur?‹ fragte Krause mich liebenswürdig.
Ich nickte. ›Reinhart hat einen van Gogh, für den ich einen Monat meines Lebens hingeben würde.‹
›Welchen Monat?‹ fragte Helen.
›Welchen van Gogh?‹ fragte Krause.
›Den Garten im Irrenhaus.‹
Krause lächelte. ›Ein herrliches Bild!‹
Er begann von anderen Gemälden zu sprechen, und da er auf den Louvre kam, konnte ich, dank der Schulung durch den toten Schwarz, mitreden. Ich begriff jetzt auch Helens Taktik; sie wollte vermeiden, daß ich als ihr Mann oder als Emigrant erkannt würde. Die deutschen Konsulate waren nicht über Anzeigen bei der Fremdenpolizei erhaben. Ich spürte, daß Krause herauszufinden versuchte, in welchem Verhältnis ich zu Helen stände. Sie hatte das bereits gewußt, ehe er auch nur fragen konnte, und dichtete mir jetzt eine Frau - Lucienne - und zwei Kinder an, von denen die ältere Tochter hervorragend Klavier spielte.
Krauses Augen gingen flink zwischen uns hin und her. Er benützte das Gespräch, um herzlich eine neue Zusammenkunft vorzuschlagen - vielleicht ein Lunch in einem der kleinen Fischrestaurants am See -, man treffe so selten Menschen, die wirklich etwas von Bildern verständen.
Ich stimmte ebenso herzlich zu - wenn ich wieder nach der Schweiz käme. Das wäre etwa in vier bis sechs Wochen. Er war überrascht; er hätte geglaubt, ich wohne in Genf. Ich erklärte ihm, daß ich Genfer sei, aber in Belfort lebe. Belfort liegt in Frankreich; er konnte da nicht so leicht nachforschen. Beim Abschied konnte er die letzte Frage dieses Verhörs nicht lassen: wo Helen und ich uns getroffen hätten; es wäre doch so selten, sympathische Menschen zu finden.
Helen sah mich an. ›Beim Arzt, Herr Krause. Kranke Menschen sind so oft sympathischer als -‹ sie lächelte ihn boshaft an ›- die Gesundheitsprotzen, denen selbst im Gehirn Muskeln wachsen statt Nerven.‹
Er nahm diesen Schuß mit einem Augurenblick.
›Ich verstehe, gnädige Frau.‹
›Gehört Renoir bei Ihnen nicht schon zur entarteten
Kunst?‹ fragte ich, um nicht hinter Helen zurückzubleiben. ›Van Gogh doch sicher.‹
›Nicht für uns Kenner‹, erwiderte Krause mit einem zweiten Augurenblick und glitt zur Tür hinaus.
›Was wollte er?‹ fragte ich Helen.
›Spionieren. Ich wollte dich warnen, nicht zu kommen; aber du warst schon auf dem Weg. Mein Bruder hat ihn geschickt. Wie ich das alles hasse!‹
Der schattenhafte Arm der Gestapo hatte über die Grenze gegriffen, um uns daran zu erinnern, daß wir noch nicht ganz entkommen waren. Krause hatte Helen gesagt, sie möge gelegentlich ins Konsulat kommen. Nichts Wichtiges, aber die Pässe müßten einen neuen Stempel haben. Eine Art Ausreiseerlaubnis. Das sei versäumt worden.
›Er sagt, es sei eine neue Verordnung‹, erklärte Helen.
›Er lügt‹, erwiderte ich. ›Ich wüßte es sonst. Emigranten wissen so etwas immer sofort. Wenn du hingehst, kann es sein, daß sie dir den Paß wegnehmen.‹
›Wäre ich dann ein Emigrant wie du?‹
›Ja. Wenn du nicht zurückgingest.‹
›Ich bleibe‹, sagte sie ›Ich
Weitere Kostenlose Bücher