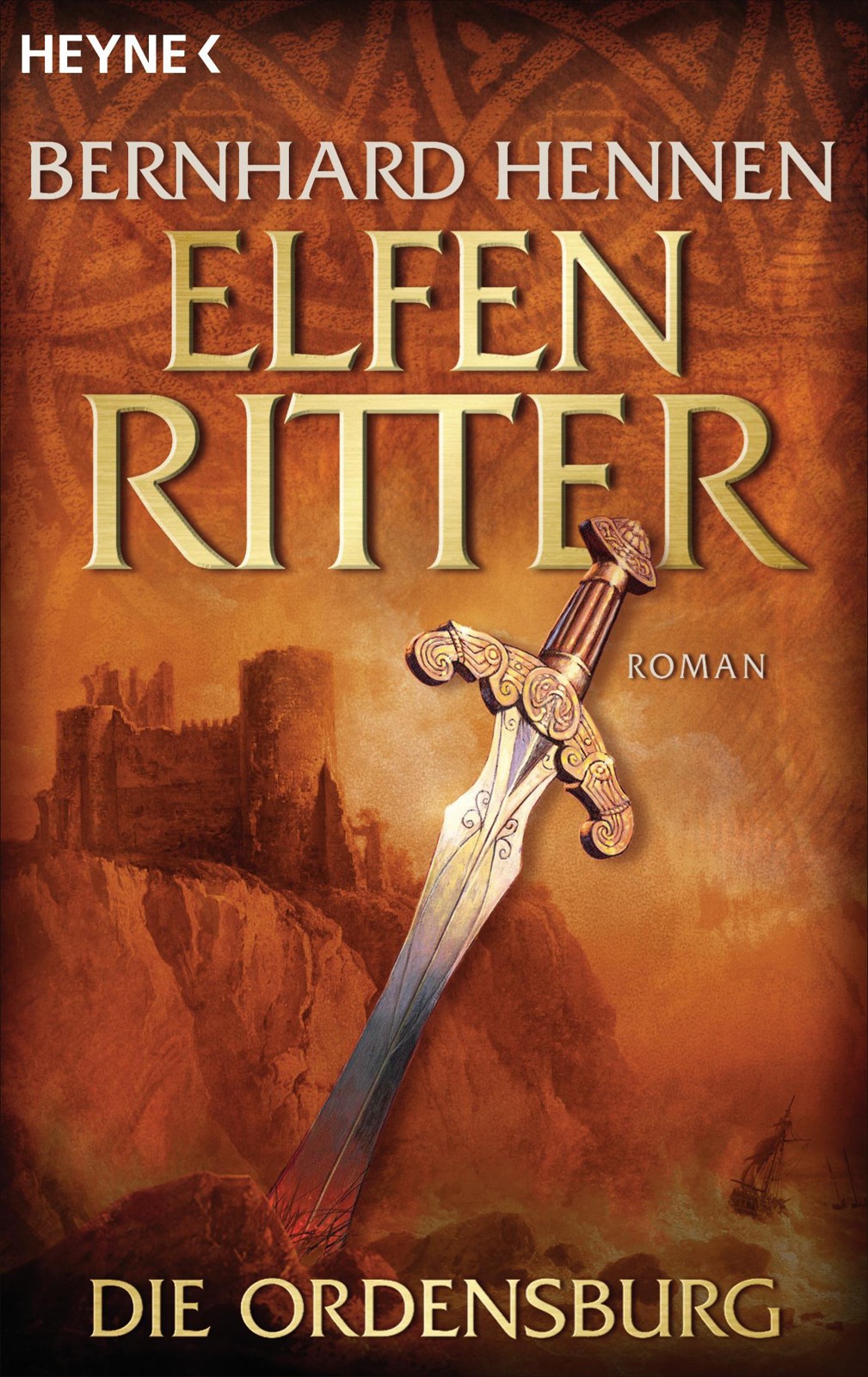![Die Ordensburg: Elfenritter 1 - Roman]()
Die Ordensburg: Elfenritter 1 - Roman
toten Elfenkrieger zu ersetzen. Die Menschen brauchten weniger als zwanzig Jahre, um aus einem Neugeborenen einen Krieger zu machen. Deshalb bestand Emerelle darauf, dass nur Schlachten ausgetragen werden durften, in denen ihre Feinde mit fürchterlichen Verlusten zu rechnen hatten. Aber auch den Freunden Albenmarks mutete sie oft genug einen hohen Blutzoll zu. Das war die Mathematik ihres Krieges. Es fiel ihm schwer, diesem Befehl zu folgen.
Tiranu sah ihn an, als könne er in seinen Gedanken lesen.
»Wir sollten die Ritter hinrichten. Damit erhöhen wir ihren Blutzoll. Es macht keinen Sinn, sie am Leben zu lassen. Sie werden unsere Todfeinde sein, solange sie atmen. Wenn wir sie freilassen, werden sie wieder das Schwert gegen uns erheben. Wir sollten sie an die Eichen am Strand nageln und verbrennen. Gewähren wir ihnen die Ehre, so zu sterben wie ihr Lieblingsheiliger Guillaume. Schaffen wir sie uns vom Hals. Außerdem halten sie es genauso. Sie bringen unsere Gefangen um. Warum sollten wir ihnen gegenüber Gnade walten lassen?«
»Ich werde die Ritter zählen, bevor ich gehe. Wenn auch nur einer von ihnen tot ist, wenn ich zurückkehre, wirst du dir wünschen, mich niemals gekannt zu haben.«
»Viele von ihnen sind schwer verletzt«, wandte Tiranu ein. »Ich kann keine Wunder wirken.«
»Dann lerne es. Es gibt doch Heilkundige unter deinen Männern. Lass sie um das Leben der Menschen ringen! Leiste dir keinen Toten!«
»Du bist verrückt. Du bist zu weich, um ein Feldherr zu sein.«
Fenryl sah dem Fürsten in die harten, dunklen Augen.
»Weißt du, ich kann die Ordensritter bekämpfen, weil ich mir bewusst bin, worin ich mich von ihnen unterscheide. Wenn ich werde wie sie, um sie vermeintlich besser bekämpfen zu können, was für Werte verteidige ich dann noch? Haben sie dann nicht gewonnen, selbst wenn ich sie auf dem Schlachtfeld bezwinge?«
»Das sind Gedanken für Philosophen, die vor dem wirklichen Leben die Augen verschließen und ihren schöngeistigen Idealen nachhängen. Sie können nur deshalb existieren, weil es Männer wie uns gibt, die mit dem Schwerte in der Hand dafür sorgen, dass die Ordensritter nicht nach Albenmark kommen, um unsere Philosophen mit ihren Bibliotheken zu verbrennen, ganz so, wie sie es in Iskendria getan haben.«
Es war müßig, mit Tiranu zu diskutieren. Er sollte dafür sorgen, dass dem Fürsten von Langollion jedwedes Kommando entzogen wurde. Tiranu hatte die eigentlichen Ziele aus den Augen verloren. Zugleich musste sich Fenryl eingestehen, dass er im Augenblick keine andere Wahl hatte, als Tiranu den Befehl zu übergeben. Zum Glück war es nur für ein paar Stunden!
»Wenn ich wiederkehre, wird keiner der Ritter tot sein«, wiederholte Fenryl in ruhigem Tonfall. »Sollte dir das nicht gelingen, werde ich ein Standgericht einberufen und dich des Mordes anklagen.«
»Wie sagtest du auch gleich? Die Schlacht ist geschlagen.
Der Feind flieht, damit gibt es keine Basis mehr für die Anwendung des Standrechts. Ich fürchte, du verkennst deine Möglichkeiten.«
»Glaubst du? Oder begehst du vielleicht gerade den Fehler, mich für einen Mann zu halten, der Recht und Moral stärker verbunden ist, als dies tatsächlich der Fall ist? Vertraue lieber auf die Kunstfertigkeit unserer Heiler als darauf, dass ich davor zurückschrecken werde, dich an einen Baum nageln zu lassen, wenn ich dich für einen Mörder halte.«
»Du stehst hier vor mir, in einer Rüstung, bespritzt mit dem Blut der Feinde, die du in der Schlacht erschlagen hast, und warnst mich davor, nicht zum Mörder zu werden. Ist dir nicht klar, wie absurd das ist?«
»Absurd in deiner Art, die Welt zu sehen. Ich bin mit mir im Reinen. Und ich warne dich. Unterschätze meinen Willen nicht, meine Befehle ausgeführt zu sehen. Nun geh und sorge dich um die Verwundeten!«
Einen Augenblick schien es, als wolle Tiranu noch etwas erwidern. Er öffnete den Mund … sagte dann aber nichts. Mit einem letzten arroganten Lächeln drehte er sich um und ging davon.
Fenryl war sich bewusst, dass er undiplomatisch vorgegangen war. Bisher hatte Tiranu ihn nur für einen Weichling gehalten und verachtet. Nun hatte er in dem Fürsten einen Feind.
Manchmal wünschte er sich, er könnte einfach in die Einsamkeit der weiten Eisebenen seiner Heimat zurückkehren und all seinen Pflichten den Rücken kehren. Doch wer würde ihm folgen? Gewiss nicht Ollowain. Er war der Kriege müde geworden. Vielleicht wäre Yulivee eines Tages
Weitere Kostenlose Bücher