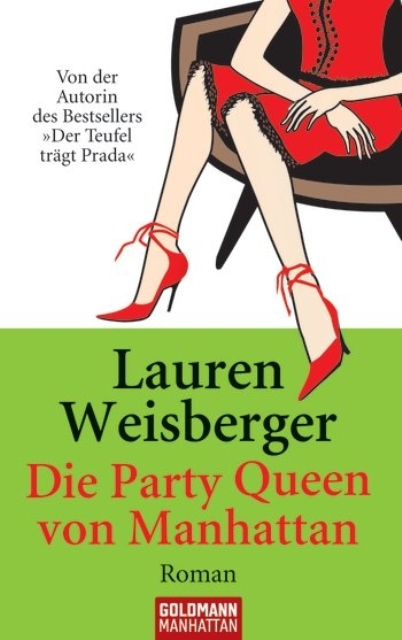![Die Party Queen von Manhattan - Roman]()
Die Party Queen von Manhattan - Roman
Sammys Anruf noch immer nicht verdaut. Er hatte mir erklärt, er könne nicht zu der Party kommen und würde -
schlimmer noch - auch nicht mit mir zurückfahren. So nett die Hinfahrt gewesen sei, aber er müsse Samstagabend arbeiten und nehme deshalb den Bus. Ich hatte kurz überlegt, auch schon früher zu fahren, aber daran wären meine Eltern mit Sicherheit nicht sehr erbaut gewesen. Also wünschte ich ihm nur noch einen schönen Abend und legte auf.
»Hey, Bettina, kannst du mir hier wohl ein bisschen zur Hand gehen?« Mein Vater war damit beschäftigt, liebevoll einen Haufen Zweige und Brennholz in höchst komplizierter Flechttechnik übereinander zu schichten. Es war das Herzstück eines jeden Erntedankfests, das große Freudenfeuer, um das sich alle scharten, wo getanzt, Wein getrunken und »der Ernte gehuldigt« wurde, was immer das hieß.
Ich eilte ihm zu Hilfe. In meiner so zünftigen wie zwanglosen Kluft - ausgeleierte Cordhose, die noch aus Highschoolzeiten stammte, Wolljacke und dicker Fleecepullover - fühlte ich mich fremd und pudelwohl zugleich: endlich befreit von den windigen Tanktops und den hautengen, hinternliftenden, schenkelstraffenden Jeans, die ich mittlerweile fast schon aus tiefster Überzeugung trug. Meine Füße steckten in flauschigen Angorasocken und butterweichen Mokassins mit Gummisohle, Perlenstickerei und Fransenbesatz - damals in den Augen der Modebewussten an der Highschool eine schauerliche Geschmacksverirrung, aber ich hatte sie trotzdem getragen. Und trug sie nun wieder, mit dem Unterschied, dass sie jetzt auf jeder zweiten Seite von Lucky abgebildet waren. Es kam mir ein bisschen unredlich vor, aber die Dinger waren einfach viel zu bequem, um ihretwegen Prinzipienreiterei zu betreiben. Ich füllte meine Lunge tief mit spätherbstlicher Luft und überlegte, ob es sein konnte, dass ich mich rundum glücklich und zufrieden fühlte.
»Also, Dad, was soll ich machen?«
»Dir den Stapel da beim Wintergarten vornehmen und hier rübertragen, wenn’s geht«, sagte er und lud sich ächzend einen halben Baumstamm auf die Schulter.
Er warf mir ein Paar riesige Arbeitshandschuhe zu, die von all den Erdarbeiten längst pechschwarz geworden waren. Ich ließ meine Hände in den Dingern verschwinden und begann, ein Holzscheit nach dem anderen zu verlegen.
Meine Mutter verkündete, sie ginge jetzt unter die Dusche, und in der Küche stünde eine Kanne ägyptischer Yogi-Lakritz-Tee. Wir gossen uns jeder eine Tasse ein und machten Päuschen.
»So, nun erzähl mal, Bettina. Wie stehst du zu dem Pfundskerl, den du da gestern Abend angeschleppt hast?«
»Pfundskerl?«, gab ich zurück - eher um Zeit zu schinden, als mich über den Ausdruck lustig zu machen. Logisch, die zwei brannten darauf, von mir zu hören, dass Sammy und ich ein Paar waren - und ich hätte ihnen den Gefallen weiß Gott mehr als gern getan -, aber ihnen jetzt das ganze Drum und Dran auseinander zu klamüsern, das war mir echt zu viel.
»Dir ist natürlich klar, dass deine Mutter und ich uns für dich letztlich so einen Knaben erträumen wie den von Penelope. Wie heißt er doch gleich wieder?«
»Avery.«
»Ja, genau, Avery. Der hätte uns sicher bis ans Lebensende mit Gras vom Feinsten versorgt, aber nachdem dieser Traummann offenbar schon vergeben ist, könnten wir uns mit Sammy durchaus anfreunden.« Er musste über seinen Witz selbst schmunzeln.
»Tja, also, was großartig Aufregendes gibt’s da irgendwie nicht zu berichten. Ich hab ihn eigentlich bloß bis hierher mitgenommen.« Weiter wollte ich das Thema nicht vertiefen - irgendwie war ich dem Gefühl nach doch schon ein bisschen über das Alter hinaus, in dem ich Mom und Dad an meinen Liebeswirren teilhaben ließ.
Er nippte an seinem Tee und schaute mich über den Rand des Bechers hinweg an, dessen Aufdruck ihn als Friedensveteran auswies. Meine Eltern in irgendeiner Hinsicht als Veteranen zu bezeichnen, strafte ihren ungebrochenen Tatendurst
Lügen, aber ich enthielt mich jeglichen Kommentars. »Na gut, okay. Und wie geht’s dir mit deinem neuen Job?«
Volle vierundzwanzig Stunden hatte ich keinen Gedanken an die Arbeit verschwendet, doch mit einem Mal verspürte ich das panische Bedürfnis, meine SMS zu checken. Ein Glück, dass mein Handy hier keinen Empfang hatte; und die Nachrichten über den Festnetzanschluss meiner Eltern abzurufen, war mir nun doch zu blöd.
»Eigentlich gar nicht mal so schlecht«, sagte ich schnell. »Viel besser als erwartet.
Weitere Kostenlose Bücher