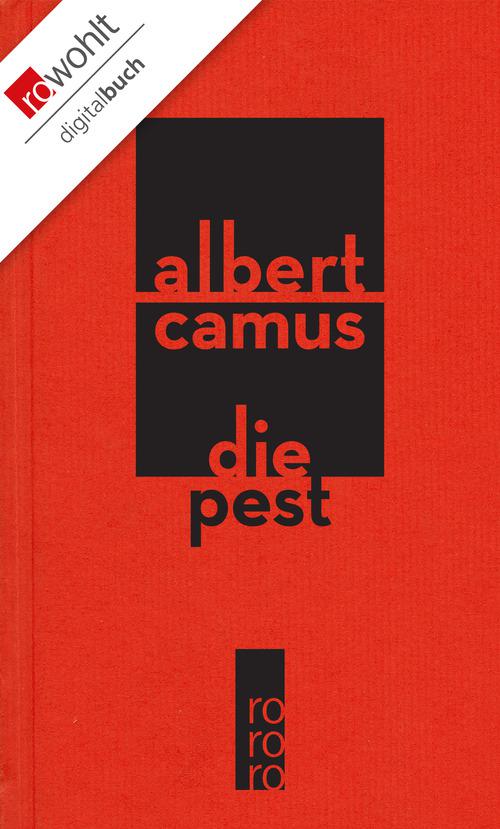![Die Pest (German Edition)]()
Die Pest (German Edition)
zurück bis in seine Stirn, als habe es irgendeinen inneren Damm gebrochen. Als Tarrous Blick sich wieder auf den Arzt richtete, ermutigte der ihn mit seinem angespannten Gesicht. Das Lächeln, das Tarrou noch einmal versuchte, konnte nicht durch die zusammengepressten Kiefer und die von weißlichem Schaum zuzementierten Lippen dringen. Aber in dem verhärteten Gesicht leuchteten die Augen noch mit dem ganzen Glanz des Mutes.
Um sieben Uhr trat Madame Rieux ins Zimmer. Der Arzt ging in sein Büro, um im Krankenhaus anzurufen und dafür zu sorgen, dass er vertreten wurde. Er beschloss auch, seine Sprechstunde zu verschieben, legte sich einen Moment auf den Diwan in seinem Sprechzimmer, stand aber fast sofort wieder auf und ging in das Schlafzimmer zurück. Tarrou hielt den Kopf Madame Rieux zugewandt. Er sah den kleinen Schatten an, der zusammengesunken, mit im Schoß gefalteten Händen neben ihm auf einem Stuhl saß. Und er betrachtete Madame Rieux so eindringlich, dass sie einen Finger auf den Mund legte und sich erhob, um die Nachttischlampe auszumachen. Aber das Tageslicht drang schnell durch die Vorhänge, und als kurz darauf das Gesicht des Kranken aus der Dunkelheit auftauchte, konnte Madame Rieux sehen, dass er sie noch immer ansah. Sie beugte sich zu ihm, rückte sein Kopfpolster zurecht und legte, als sie sich aufrichtete, einen Augenblick die Hand auf sein feuchtes, wirres Haar. Da hörte sie, wie eine gedämpfte Stimme wie von ferne «Danke» zu ihr sagte und dass jetzt alles gut sei. Als sie wieder saß, hatte Tarrou die Augen zugemacht, und sein erschöpftes Gesicht schien trotz des fest verschlossenen Mundes wieder zu lächeln.
Am Mittag war das Fieber auf seinem Höhepunkt. Ein wie aus den Eingeweiden kommender Husten schüttelte den Körper des Kranken, der erst jetzt Blut zu spucken begann. Die Lymphknoten waren nicht mehr weiter angeschwollen. Sie waren immer noch da, hart wie in die Gelenkhöhlen geschraubte Muttern, und Rieux hielt es für unmöglich, sie aufzuschneiden. Zwischen den Husten- und Fieberschüben sah Tarrou seinen Freund hin und wieder noch an. Aber bald öffneten sich seine Augen seltener und seltener, und das Leuchten, das dann sein verwüstetes Gesicht erhellte, wurde jedes Mal blasser. Der Gewittersturm, der diesen Körper mit zuckenden Krämpfen schüttelte, erleuchtete ihn mit immer selteneren Blitzen, und Tarrou trieb langsam in die Tiefe dieses Sturms ab. Rieux hatte nur noch eine nunmehr regungslose Maske vor sich, aus der das Lächeln verschwunden war. Diese menschliche Gestalt, die ihm so nahe gewesen war, nun von Jagdspießen durchbohrt, von einem übermenschlichen Übel verbrannt, von allen hasserfüllten Winden des Himmels verkrümmt, versank vor seinen Augen in den Wassern der Pest, und er konnte nichts gegen diesen Untergang tun. Er musste mit leeren Händen und zerrissenem Herzen am Ufer zurückbleiben, einmal mehr hilflos und ohne Waffen gegen dieses Unheil. Und am Ende waren es Tränen der Ohnmacht, die verhinderten, dass Rieux sah, wie Tarrou sich abrupt zur Wand drehte und mit einem hohlen Klagelaut erlosch, so als wäre irgendwo in ihm eine lebensnotwendige Saite gerissen.
Die folgende Nacht war keine Nacht des Kampfes, sondern eine der Stille. In diesem von der Welt abgeschnittenen Zimmer spürte Rieux über dem nun angekleideten Leichnam die überraschende Ruhe schweben, die viele Nächte zuvor auf den Terrassen über der Pest dem Angriff auf die Tore gefolgt war. Schon damals hatte er an jene Stille gedacht, die von den Betten emporstieg, in denen er Menschen hatte sterben lassen. Es war überall das gleiche Innehalten, die gleiche feierliche Zwischenzeit, die immer gleiche Besänftigung, die den Kämpfen folgte, die Stille der Niederlage. Aber jene, die jetzt seinen Freund einhüllte, war so dicht, sie war so sehr eins mit der Stille der Straßen und der von der Pest befreiten Stadt, dass Rieux deutlich fühlte, dass es sich diesmal um die endgültige Niederlage handelte, die, die Kriege beendet und selbst aus dem Frieden ein unheilbares Leiden macht. Der Arzt wusste nicht, ob Tarrou schließlich Frieden gefunden hatte, aber wenigstens in diesem Augenblick glaubte er zu wissen, dass für ihn selbst nie wieder ein Frieden möglich sein würde, ebenso wenig wie es für die Mutter, die ihren Sohn verloren hat, oder für den Mann, der seinen Freund begräbt, einen Waffenstillstand gibt.
Draußen herrschte die gleiche kalte Nacht mit gefrorenen Sternen an
Weitere Kostenlose Bücher