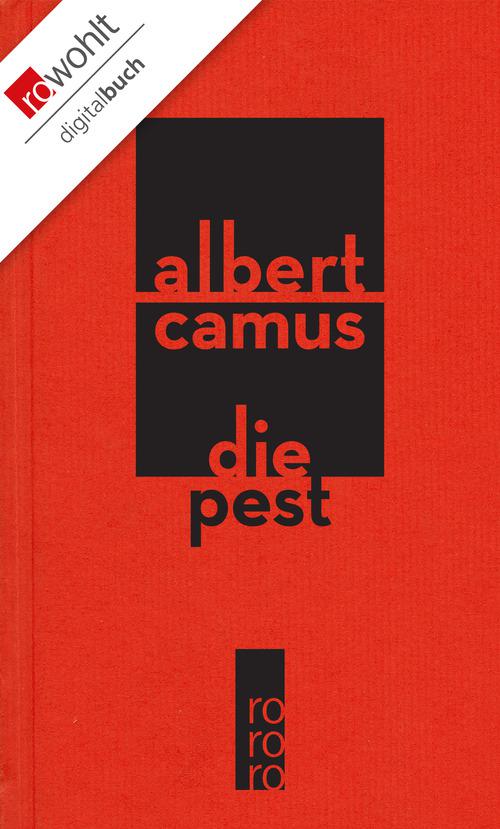![Die Pest (German Edition)]()
Die Pest (German Edition)
treten, die sich am Ende immer als illusorisch erwiesen. Selbst wenn einige der Mittel, die wir uns ausgedacht hatten, erfolgreich waren, wussten wir nichts davon, da wir ja keine Antwort bekamen. Wochenlang mussten wir uns damals darauf beschränken, immer wieder denselben Brief noch einmal anzufangen, immer wieder dieselben Appelle aufzuschreiben, sodass die Worte, die zuerst mit unserem Herzblut geschrieben waren, nach einer gewissen Zeit jeden Sinn verloren. Wir schrieben sie nun mechanisch wieder auf, ein Versuch, mit Hilfe dieser toten Sätze Zeichen von unserem schwierigen Leben zu geben. Und am Ende schien uns dann der konventionelle Appell des Telegramms besser als dieser unfruchtbare hartnäckige Monolog, dieses öde Gespräch mit einer Wand.
Als nach einigen Tagen klar wurde, dass niemand aus unserer Stadt hinausgelangen würde, kam man übrigens auf die Idee, sich zu fragen, ob nicht den vor der Epidemie Verreisten die Rückkehr gestattet werde. Nach tagelangem Überlegen antwortete die Präfektur mit Ja. Sie legte aber fest, dass die Heimkehrer auf keinen Fall wieder aus der Stadt hinaus dürften und dass es ihnen zwar freistehe zu kommen, aber nicht, wieder zu gehen. Auch da nahmen einige, übrigens wenige, Familien die Situation auf die leichte Schulter; sie stellten den Wunsch, ihre Verwandten wiederzusehen, über jede Vorsicht und forderten diese auf, die Gelegenheit zu nutzen. Aber sehr schnell begriffen die Gefangenen der Pest, welcher Gefahr sie ihre Angehörigen aussetzten, und fanden sich damit ab, unter dieser Trennung zu leiden. Als die Krankheit am schlimmsten wütete, gab es nur einen Fall, in dem die menschlichen Gefühle stärker waren als die Angst vor einem qualvollen Tod. Es ging dabei nicht, wie man hätte erwarten können, um zwei Liebende, die die Liebe über das Leid hinweg zueinander trieb. Es handelte sich nur um den alten Doktor Castel und seine Frau, die seit vielen Jahren verheiratet waren. Madame Castel war einige Tage vor der Epidemie in eine benachbarte Stadt gefahren. Es war nicht einmal eine jener Ehen, die der Welt das Bild eines mustergültigen Glücks darbieten, und der Erzähler ist imstande zu sagen, dass diese Eheleute aller Wahrscheinlichkeit nach bis dahin nicht sicher waren, ob ihre Ehe sie zufriedenstellte. Aber diese gewaltsame, anhaltende Trennung hatte ihnen die Gewissheit verschafft, dass sie ohne einander nicht leben konnten und dass neben dieser plötzlich zutage getretenen Wahrheit die Pest belanglos war.
Dies war eine Ausnahme. In den meisten Fällen, das lag auf der Hand, sollte die Trennung erst mit der Epidemie enden. Und das Gefühl, das unser Leben bestimmte und das wir doch gut zu kennen meinten (die Oraner haben, wie gesagt, schlichte Leidenschaften), nahm für uns alle eine neue Form an. Ehemänner und Liebhaber, die das größte Vertrauen in ihre Gefährtin hatten, entdeckten, dass sie eifersüchtig waren. Männer, die sich in der Liebe für leichtfertig hielten, wurden beständig. Söhne, die bei ihrer Mutter gelebt und sie kaum angesehen hatten, lasen den Grund für ihre ganze Besorgnis und Reue aus einer Falte ihres Gesichts ab, die sie in der Erinnerung verfolgte. Diese nahtlos eingetretene gewaltsame Trennung ohne absehbare Zukunft machte uns fassungslos, unfähig zu reagieren auf die Erinnerung an diese noch so nahe und schon so ferne Gegenwart, die jetzt unsere Tage erfüllte. Tatsächlich litten wir doppelt – einmal unter unserem Leid und dann unter dem, das wir den Abwesenden, dem Sohn, der Gattin oder Geliebten, andichteten.
Unter anderen Umständen hätten unsere Mitbürger übrigens einen Ausweg in einem äußerlicheren und aktiveren Leben gefunden. Aber die Pest machte sie untätig, zwang sie dazu, sich in ihrer trostlosen Stadt im Kreis zu drehen, Tag um Tag den trügerischen Spielen der Erinnerung ausgeliefert. Denn ihre ziellosen Spaziergänge führten sie immer wieder auf dieselben Wege, und meistens waren diese Wege, in einer so kleinen Stadt, genau jene, die sie in einer anderen Zeit mit dem Abwesenden gegangen waren.
So brachte die Pest unseren Mitbürgern als Erstes das Exil. Und der Erzähler ist überzeugt, dass er hier im Namen aller schreiben darf, was er selbst empfunden hat, da er es ja mit vielen unserer Mitbürger zugleich empfunden hat. Ja, diese Leere, die wir ständig in uns trugen, war wirklich das Gefühl des Exils, diese deutliche Empfindung, der unvernünftige Wunsch, uns in die Vergangenheit
Weitere Kostenlose Bücher