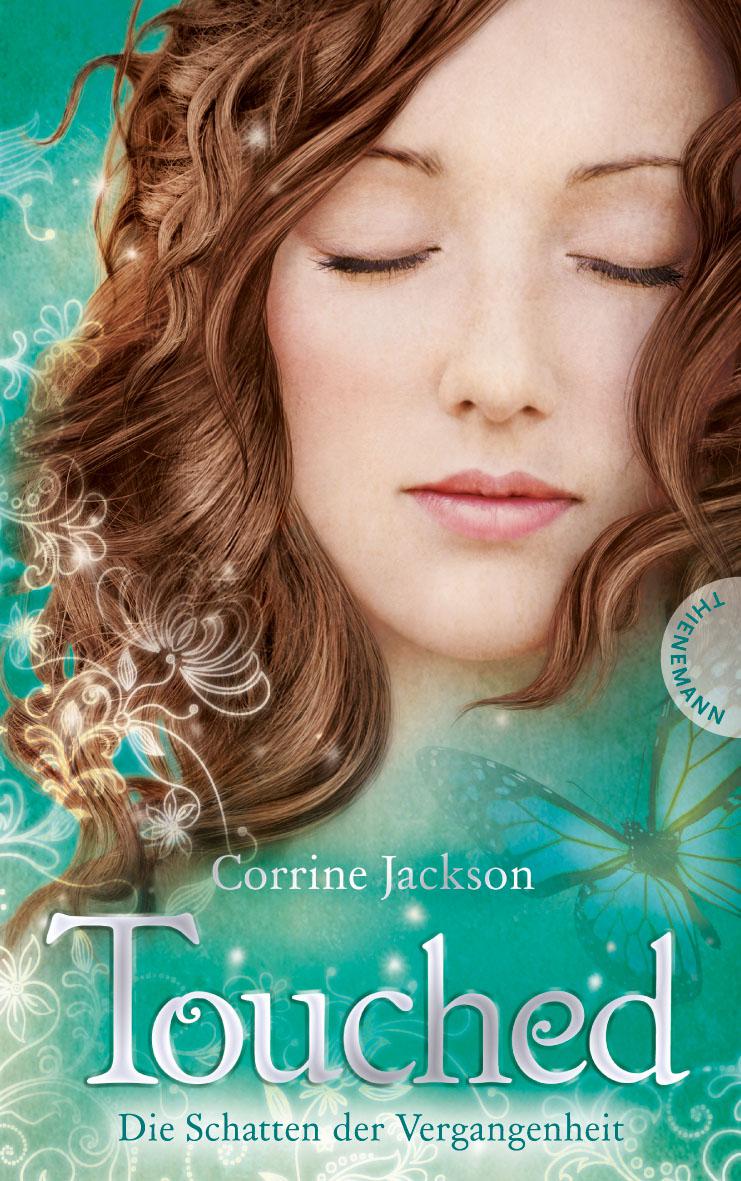![Die Schatten der Vergangenheit]()
Die Schatten der Vergangenheit
mich zu wehren, und vorbei kam ich an ihm sowieso nicht. Der Grund für seinen Anruf wurde klar, als er mit einem Erste-Hilfe-Kasten und weiteren sauberen Handtüchern ins Badezimmer zurückkehrte.
Mit Alkoholpads säuberte er die Schnittwunden. Als er inder Schusswunde nach der Kugel suchte, wurde mir schwarz vor Augen, und ich krallte die Fingernägel in seinen Unterarm. Dass er daraufhin blutete, ließ ihn kalt. Seine Berührungen blieben unpersönlich, fast glichen sie denen eines Arztes bei einer Patientin, aber weniger demütigend war das Ganze deshalb nicht. Wie ich da fast nackt vor ihm lag, fühlte ich mich unendlich verwundbar. Wie schon zuvor bei Dean, besann ich mich auf mein ältestes Verteidigungsmittel. Ich schnitt mich von all meinen Gefühlen ab.
Als er meine schlimmsten Verletzungen versorgt hatte, setzte er mich auf, kniete sich neben mich und wischte sich die blutigen Hände an einem Handtuch ab. Unvermittelt wurde mir schwummrig, und ich heftete meinen Blick an die Wand gegenüber und strengte mich an, nicht umzukippen.
»Fertig?«, fragte ich, als ich die angespannte Stille nicht länger ertrug.
Aus dem Augenwinkel sah ich, dass er den Kopf schüttelte. »Wieso heilst du dich nicht selbst?«
Die unverblümte Frage rüttelte mich auf, und ich sah ihn an. Ich schwankte, und er drückte mich wieder hoch, lotste mich an die Wand, wo ich mich anlehnen konnte.
»Dein Arm ist gebrochen.«
»Und wem hab ich das zu verdanken?!«
Er tat, als hätte ich nichts gesagt. »Ich hab’s geschafft, die Kugel zu entfernen. Zum Glück hat sie kein Organ erwischt. Aber die Wunde hört einfach nicht auf zu bluten.«
Wie zum Beweis zog er an dem frischen Handtuch, das er mir gerade auf den Bauch gedrückt hatte. Es war rot von frischem Blut. Nun, das erklärte die Schwindelgefühle. Wie viel Blut hatte ich verloren? Ich wollte erklären, dass ich mich nicht heilen konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Doch er gab mir nicht die Chance dazu.
»Du musst es stillen«, forderte er mich auf und drückte das Handtuch wieder auf meinen Bauch. »Heil dich!«
Der Befehl machte mich wütend. Die letzten beiden Tage war mir jede Entscheidung gestohlen worden. Ich war geschlagen und gefoltert worden. Die Dreckskerle, die Asher umgebracht hatten, hatten mich als Spielzeug benutzt. Und ich hatte nichts anderes tun können, als es hinzunehmen. Schluss damit!
»Nein!«, flüsterte ich. »Vielleicht möchte ich ja nicht mehr leben.«
»So ein Quatsch! Dann hilf mir, dich zu heilen, Remy.«
Er meinte, ich solle seine Energie einsetzen, um mich zu heilen. Asher hatte mir auf diese Weise hunderte Male beigestanden, aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, meine Energie mit Gabriels zu vermischen. Seine Berührungen und seine Ähnlichkeit zu Asher schmerzten schon genug.
»Nein!«
Gabriel hörte gar nicht zu. Er fing an zu reden und hörte nicht mehr auf. Er ließ mir keine Ruhe. Redete immer weiter auf mich ein. Ich hatte die Nase voll davon und machte dicht. Ich saß mit Gabriel in einem Motelbadezimmer, aber ich hatte mich in mich selbst zurückgezogen. Ich war nicht Allgemeinbesitz und ließ mich nicht herumkommandieren. Lieber war ich tot. Ohne Asher, warum eigentlich nicht?
Endlich herrschte Stille. Ich beobachtete, wie Gabriel aufgab und die Schultern niedergeschlagen hängen ließ. Er lehnte sich mir gegenüber an die Wand. Unsere Füße berührten sich fast. Er stützte die Ellbogen auf die Knie und legte den Kopf in seine Hände. Er wischte sich mit den Fingern über das Gesicht, und ich begriff, dass er weinte. Gabriel, der große, böse Beschützer, weinte. Ich hatte gar nicht gewusst, dass er dazu in der Lage war.
»Asher wusste, dass er vielleicht für dich sterben würde. Er wusste, es könnte passieren, aber er liebte dich so sehr, dass er das in Kauf genommen hat.« Gabriels tiefe Stimme hallte im Badezimmer wider. »Mein Bruder starb bei dem Versuch, dich zu retten«, fuhr er in stockendem Ton fort. »Und du Feigling dankst ihm das auf diese Weise?«
Dieser Vorwurf schmerzte mehr als jede Wunde an meinem Körper. Damit ich nicht losschluchzte, presste ich mir eine Faust vor den Mund.
»Ich kann nicht«, flehte ich Gabriel an. »Nicht ohne ihn!«
»Doch, du kannst. Du triffst eine Wahl. Und zwar die falsche, die, die einer Beleidigung meines Bruders gleichkommt!« Wieder erhob er sich vor mir auf die Knie, aber als ich vor ihm zurückwich, fasste er mich nicht an. »Und was ist mit deiner
Weitere Kostenlose Bücher