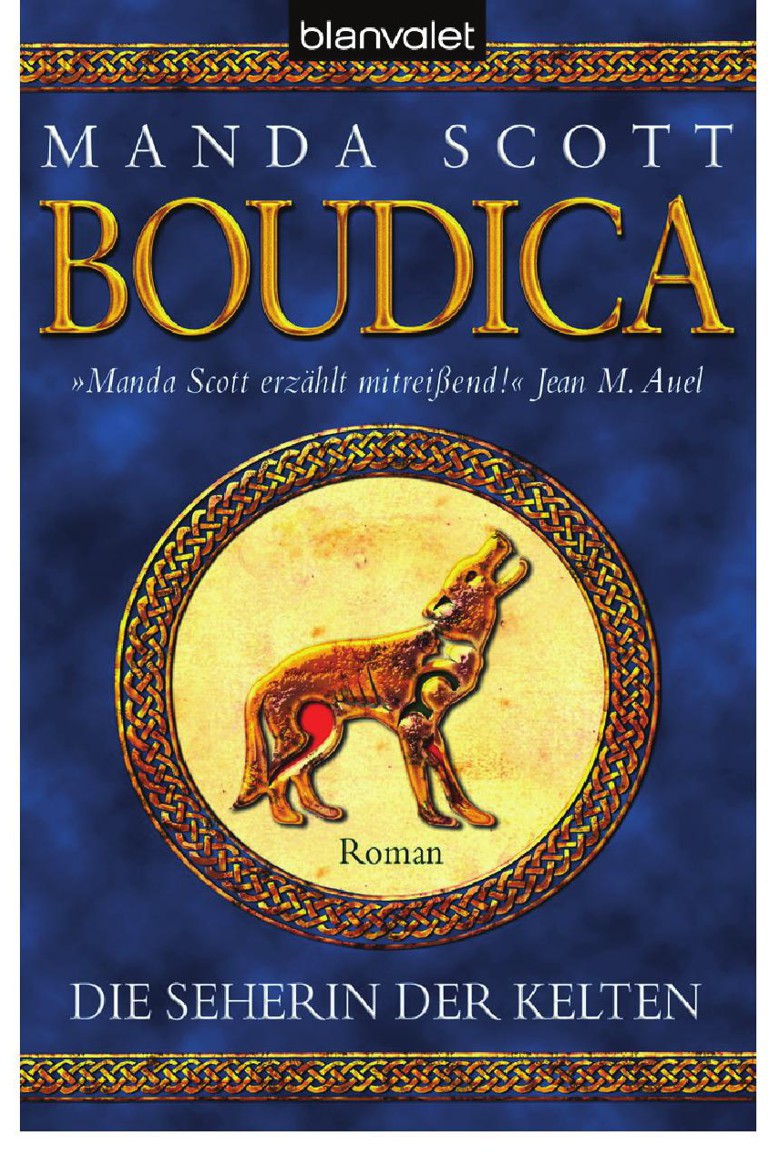![Die Seherin der Kelten]()
Die Seherin der Kelten
In der Zwischenzeit war der Mond aufgegangen, doch er stand noch nicht hoch genug am Himmel, um Licht in den Wald zu werfen. Allein das trübe Sternenlicht erlaubte Breaca, irgendetwas zu sehen, und was sie sah, war bloß verschwommen zu erkennen.
Sie hätte als Erste das Wort ergreifen können, entschied sich aber dagegen; es stand einfach zu viel auf dem Spiel, und es gab so vieles, was sie noch nicht wusste. Es genügte also, wenn sie sich einfach nur so sehen ließ, wie sie war: allein und lediglich leicht bewaffnet. Mehr wagte sie nicht zu riskieren.
Nach einem Moment ertönte von ihrer Rechten her Cunomars leise Stimme. »Woher hast du gewusst, dass ich es bin?«, fragte er. »Hat Graine es dir gesagt?« In den dreizehn langen Monaten seiner Abwesenheit war die Stimme ihres Sohnes um einiges tiefer und dunkler geworden. Sie war jetzt volltönend, besaß eine Bestimmtheit, die sehr an seinen Vater erinnerte. Cunomar hörte sich neugierig an und leicht amüsiert, nicht etwa verdrießlich und abwehrbereit.
»Nein. Deine Schwester hütet ihre Geheimnisse gut. Ich habe deinen neuen Speer singen gehört und habe den Gesang aus einem Traum wiedererkannt, den ich im Frühjahr hatte, als ich dich den verwundeten Bären töten sah. Das war wirklich gute Arbeit.« Breaca gab sich höflich, so wie sie es auch bei einer Ratsversammlung tun würde, wenn sie sich einem Krieger gegenübersähe, den sie nicht sonderlich gut kannte.
Ihr Sohn legte den Kopf schief, um sie noch direkter anschauen zu können. Das fahle Licht der Sterne ließ sein helles Haar gräulich erscheinen. »Bist du in der Zeit, in der ich fort war, etwa eine Träumerin geworden?«
»Ganz und gar nicht, obwohl ich mich hin und wieder gefragt habe, ob du vielleicht Träumer geworden wärst. Manchmal können die mächtigsten der Träumer ihre Träume nämlich auch anderen menschen schicken. Wenn es um etwas geht, was von großer Bedeutung ist.«
Letzteres war eine Frage. Von ihrer Beantwortung hing mehr ab, als jeder der beiden sich je hätte anmerken lassen. Mit Graine konnte Breaca ganz offen über ihre Besorgnis und ihre verzweifelte Furcht sprechen und wie sich die eine mit der anderen verwob; mit Cunomar dagegen konnte sie das noch nicht und würde es vielleicht auch niemals können.
Während Cunomar sich seine Antwort überlegte, fuhr sein neuer Speer leise in seinem Lied fort. Die Melodie brachte den Duft von Moos mit sich und Bilder von hohen Bergen, rauschenden Wasserfällen und den eisenbitteren Geschmack von Bärenblut. Etwas unterschwelliger und nicht ganz so deutlich waren die in dem Lied mitschwingenden Stimmen von Männern zu erkennen, die in der Sprache der Kaledonier Bittgebete an die Götter der Felsen und des Waldes sprachen. Und Cunomar war einer von ihnen.
Im Wald der Eceni betrachtete Breacas Sohn nun für einen Moment schweigend seine Hände, dann hob er den Kopf und blickte seiner Mutter zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder direkt in die Augen. Er war nicht nackt, so wie er es in ihren Träumen gewesen war, dennoch konnte sie in ihm lesen und ihn durchschauen, als ob er vollkommen entblößt wäre, und genau das tat sie auch. Dabei fühlte Breaca eine Hoffnung in sich aufwallen, die sie kaum zu benennen wagte. Cunomar war nicht größer als sein Vater, aber er war breiter und kräftiger, als Caradoc es jemals gewesen war, selbst auf dem Höhepunkt seiner Kampfzeit. Er trug eine ärmellose Tunika, und auf den Rundungen beider Schultern war eine große Anzahl weißer Narben zu erkennen, ganz so, als ob er von einem Bären malträtiert worden wäre. Außer dass die Narben in zu gleichmäßigem Abstand voneinander entfernt lagen, um von Bärenklauen stammen zu können. Linien aus blauen Punkten, die sich jeweils zu beiden Seiten der Narben entlangzogen, bestätigten Breacas Vermutung; auf diese Weise kennzeichneten die Träumer der Kaledonier ihre Bären-Tänzer, indem sie mit heißen Messern in sein Fleisch schnitten und anschließend Rosshaar in die Wunde legten, damit die Narbe wulstiger wurde.
Cunomar ertrug Breacas prüfenden Blick eine ganze Weile lang ruhig und schweigend, dann sagte er: »Zum Zeitpunkt der Jagd war es für mich wichtiger als alles andere, dir zu zeigen, was ich getan hatte. Ich hatte keine Ahnung davon, dass ich dir den Traum sandte, aber ich betete zu Nemain und zu dem gehörnten Gott des Waldes, dass du sehen mögest, was ich vollbracht hatte. Wenn die Götter die Vision zu dir getragen haben,
Weitere Kostenlose Bücher