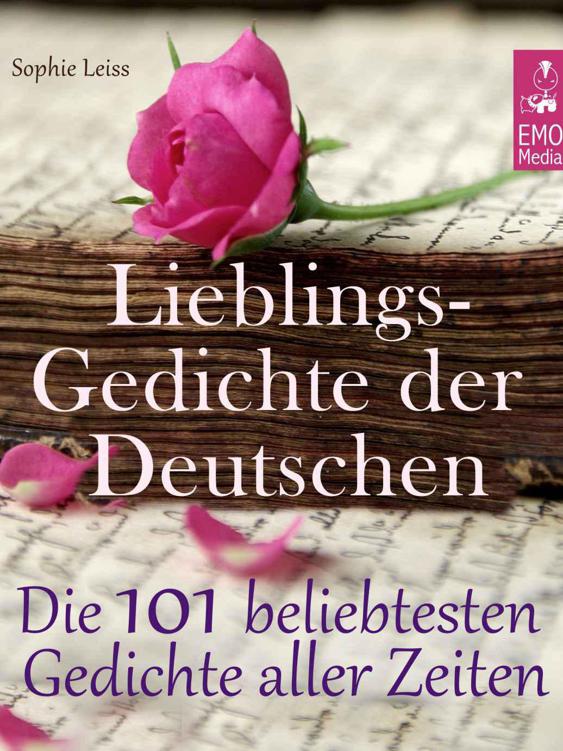![Die Sprache der Macht]()
Die Sprache der Macht
kann ich Ihnen garantieren, dass sie nicht ausreichen.“
Im ersten Fall hinterlässt der Geschäftsführer einen verheerenden Eindruck, weil er eine Frage zurückweist, für die er zuständig ist. Im zweiten Fall nimmt der Geschäftsführer die Zuständigkeit an. Er ist derjenige, der über die künftige Geschäftsentwicklung Auskunft zu erteilen hat. Er trifft eine Einschätzung, hält weitere Einschnitte für möglich, hofft aber, sie vermeiden zu können. Seine Antwort strahlt Dominanz aus, die erste Antwort das glatte Gegenteil.
Doch sollten wir eines nicht übersehen: Auch wenn der Geschäftsführer im zweiten Fall vorsichtig von Einschätzung und Hoffnung spricht, so legt er sich doch fest, im Unterschied zu Beispiel eins. Seine Einschätzung kann falsch sein; seine Hoffnung trügerisch. Womöglich muss er dann dafür geradestehen oder er verliert seine Glaubwürdigkeit. Aber es geht nun einmal nicht anders: Wer dominieren will, muss sich festlegen. Und noch etwas: Konkurrieren zwei Antwortgeber, so dominiert derjenige, der sich stärker festlegt.
Ende der Krise
Mitten in einer Absatzkrise werden zwei Branchenkenner gefragt, wann nach ihrer Einschätzung die Krise überstanden sein wird. Experte A antwortet: „Alle Prognosen sind reine Spekulation. Es hängt von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung ab. Wenn die Konjunktur wieder in Gang kommt, könnte mit einer Verzögerung von sechs bis achtzehn Monaten auch in Ihrer Branche eine Trendumkehr einsetzen. Aber eine Garantie gibt es auch dafür nicht.“ Experte B erwidert hingegen: „Nach unseren Analysen erwarten wir eine leichte Erholung schon im kommenden Frühjahr. Die Krise wird dann aber erst im folgenden Jahr wirklich überstanden sein.“
Natürlich spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie etwa die Erwartungen des Fragers und die Glaubwürdigkeit des Antwortenden. Doch für sich betrachtet, ist der Befund eindeutig: Wer sich festlegt, dominiert. Auch wenn sich seine Annahme später als Fehleinschätzung herausstellt, im Moment gewinnt derjenige die Oberhand, der möglichst wenig Zweifel und Unsicherheit aufkommen lässt.
Die Zahlen des Thilo Sarrazin
Der ehemalige Berliner Innensenator Thilo Sarrazin hatte behauptet, dass siebzig Prozent der türkischen und neunzig Prozent der arabischen Bevölkerung Berlins den Staat ablehnten. Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, meint, darüber gebe es überhaupt keine Erhebungen. In einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung erklärte Sarrazin, wenn man keine Zahl habe, dann müsse man eine „schöpfen“: „Und wenn sie keiner widerlegen kann, dann setze ich mich mit meiner Schätzung durch.“
Unterlegenheitsfragen lassen sich schwer zurückweisen
Will man sich nicht festlegen, gibt es immer noch die Möglichkeit, die Frage zurückzuweisen, umzulenken oder genüsslich zu zermalmen – all das sind bewährte Stilmittel, um sich dominant zu zeigen (→ S. 68, „Fragen zurückweisen, umlenken, zermalmen“). Das Problem ist nur: Für Unterlegenheitsfragen sind diese Methoden eher ungeeignet. Es schwächt die Position dessen, der so vorgeht. Die Unterlegenheitsfrage gibt einem ja die Möglichkeit, Überlegenheit und Bedeutung zu demonstrieren. Sie ist wie ein Podest, das einem der Frager hinstellt. Tritt man es um, wird man gewiss nicht größer.
Wie also geht jemand vor, der sich nicht festlegen möchte? Einen möglichen Ausweg bieten die „Metaphern der Macht“. Die Feinheiten dieser Methode lernen Sie im nächsten Kapitel kennen (→ S. 146, „Machtvolle Metaphern“).
Sprache der Macht im Alltag: Unterlegenheitsfragen zur Entlarvung nutzen
Den Umstand, dass Unterlegenheitsfragen so schwer zurückzuweisen sind, machen sich Machtmenschen gern zunutze. Sie stellen Unterlegenheitsfragen, so dass ihr Gegenüber auf das Podest klettert und Aussagen trifft, die ihn womöglich entlarven, oder durch die er sich festlegt (wichtig: nicht der Fragende nagelt ihn fest). Mitunter lassen sich diese Aussagen – ganz in Columbo-Manier – später gegen ihn verwenden.
Dominante Fragen
Nicht nur Antwortgeber, auch Fragesteller können dominieren. Die Frage ist das Instrument, mit dem sie ihre Überlegenheit herstellen oder demonstrieren. Selbstverständlich funktionieren diese Fragen völlig anders als diejenigen, von denen eben die Rede war. Der Fragende unterstellt sich nicht der Führung desjenigen, der ihm antworten soll. Ganz im Gegenteil: Er
Weitere Kostenlose Bücher