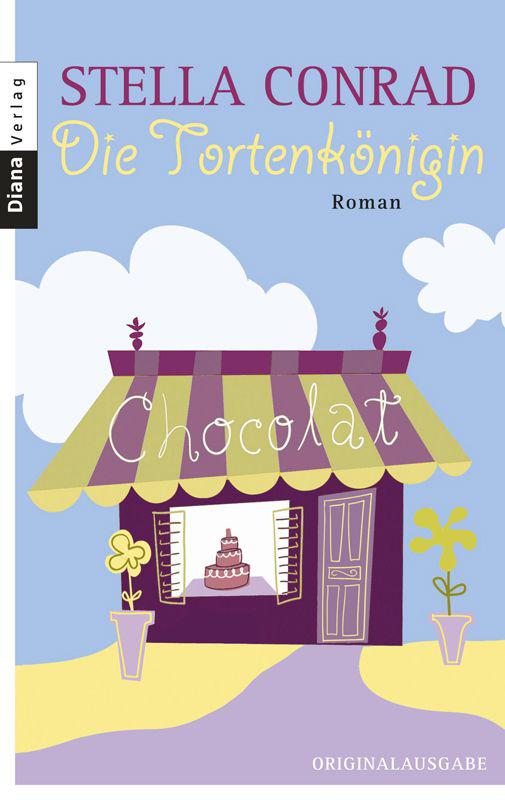![Die Tortenkönigin: Roman (German Edition)]()
Die Tortenkönigin: Roman (German Edition)
sie das Scheitern unserer Beziehung prophezeit, wenn auch mit unterschiedlichen Worten.
Peter, mein Vater: »Bist du verrückt geworden, diesem windigen Schnulzenheini hinterherzulaufen? Und wer übernimmt jetzt mein Geschäft? Habe ich dir dafür die Meisterschule bezahlt? Wenn du von hier weggehst, kannst du dein Erbe vergessen, hörst du?« (Das war ein ungewohnt emotionaler Ausbruch meines Vaters, so hatte ich ihn noch nie erlebt.)
Waltraud, meine Mutter: »Dein Vater hat recht. Wozu haben wir all die Jahre geschuftet? Für dich, damit du ein gut gehendes Geschäft übernehmen kannst. Wenn du jetzt gehst und uns mit dem Laden allein lässt, brauchst du nicht mehr wiederzukommen, hörst du? Was kann dieser … dieser … Leon dir schon bieten? Was ist er schon – ein brotloser Künstler. Und seinetwegen willst du in ein fremdes Land gehen, nach allem, was wir für dich getan haben? Wie willst du dich denn da verständigen? Kannst du überhaupt Französisch?« (Bei aller Aufregung immer noch pragmatisch, meine Mutter. Die Möglichkeit, Französisch zu lernen , existierte für sie nicht. Entweder man kann Französisch, oder man kann es nicht. Ein waltraudsches Naturgesetz.)
Cäcilie, meine Oma: »Ach, Kind, bist du wirklich sicher? Der Junge hat listige Augen – auf so einen Süßholzraspler musst du als Frau ständig aufpassen. Aber wenn du mit ihm glücklich bist, freue ich mich für dich.« (Leon hatte mich einmal bei meinen Eltern besucht und sofort eine Charme-Offensive gestartet, was ihn in den Augen meiner Sippschaft nur noch suspekter machte.)
Susanne, meine Schwester: »Der will doch nur ein Muttchen, das ihm zu Hause das Bett warm hält und ihn bekocht, wenn er von den Groupies gelangweilt ist. Wie kannst du nur so dumm sein, dafür eine gesicherte Existenz aufzugeben? Wenn ich so denken würde, wäre ich nicht das, was ich heute bin!« (Und was war sie? Die Gattin eines Dorfbürgermeisters, die sich für Jackie Kennedy hielt.)
Lutz, mein Schwager: »Du kannst nicht glauben, dass dieser Typ ernsthaft in dich verliebt ist, Helene. Sag selbst: Warum sollte er dich nehmen, wenn ihm schöne Frauen in Scharen hinterherlaufen?« (Und das ausgerechnet von Lutz mit seinem Schmerbauch und seiner Halbglatze. Irgendwann werde ich Susanne erzählen, dass er mich in angetrunkenem Zustand angebaggert hat – an ihrem Polterabend. »Noch ist es nicht zu spät für uns, Helene«, hatte er mir damals ins Ohr gelallt, »lass uns zusammen durchbrennen!« Ich habe ihn natürlich ausgelacht, und seither nutzte er jede Gelegenheit, mich zu beleidigen.)
Niemand aus meiner Familie wäre von unseren Hochzeitsplänen begeistert gewesen. Im Gegenteil. Jeder Einzelne hätte nichts unversucht gelassen, mich davon abzubringen, niemand hätte sich mit mir oder auch nur für mich gefreut. Nicht aus Missgunst, o nein, nur aus Sorge um mein Wohlergehen, selbstverständlich.
Dass ich nicht lache.
Susanne, zwei Jahre älter als ich, hatte schon als Kind keine Gelegenheit ausgelassen, mich zu übertrumpfen und mir ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Bis heute hatte sie nicht begriffen, dass sie diesen Konkurrenzkampf gegen sich selbst führte, da ich mich strikt weigerte, ihr Spiel mitzuspielen.
Deshalb war Marie so wichtig für mich – sie war nicht nur meine Freundin, sondern auch so etwas wie Familienersatz. Sie würde nach Paris kommen und meine Trauzeugin bei der kurzen Zeremonie im Rathaus sein. Die Vorbereitungen dafür mussten in aller Heimlichkeit abgewickelt werden, denn sie arbeitete ausgerechnet für meinen Schwager.
Ich konnte mich noch genau an das Telefonat erinnern, in dem Marie mir von Lutz’ Reaktion auf ihr Ansinnen, ein paar Tage Urlaub zu nehmen, erzählt hatte.
Wir nannten ihn Majestix, nach dem Häuptling des kleinen, gallischen Dorfes in den Asterix-Comics. Das war der dicke – und ziemlich dumme – Kerl, der sich immer auf seinem Schild quer durchs Dorf tragen ließ. Die Ähnlichkeit mit Lutz – oder umgekehrt – war frappant.
»Es war großartig!«, kiekste Marie vergnügt. »Seine Hoheit wollte natürlich wissen, wozu ich Urlaub brauche.«
»Wie bitte? Das geht den doch einen Dreck an. Das darf der dich gar nicht fragen.«
»Na und? Als ob den das jemals gestört hätte! Er glaubt, es steht ihm dienstgradmäßig zu, über alles und jeden in unserem Kaff Bescheid zu wissen, das kennst du doch.«
Und ob ich das kannte. Aus eigener, leidvoller Erfahrung.
»Und was hast du ihm
Weitere Kostenlose Bücher