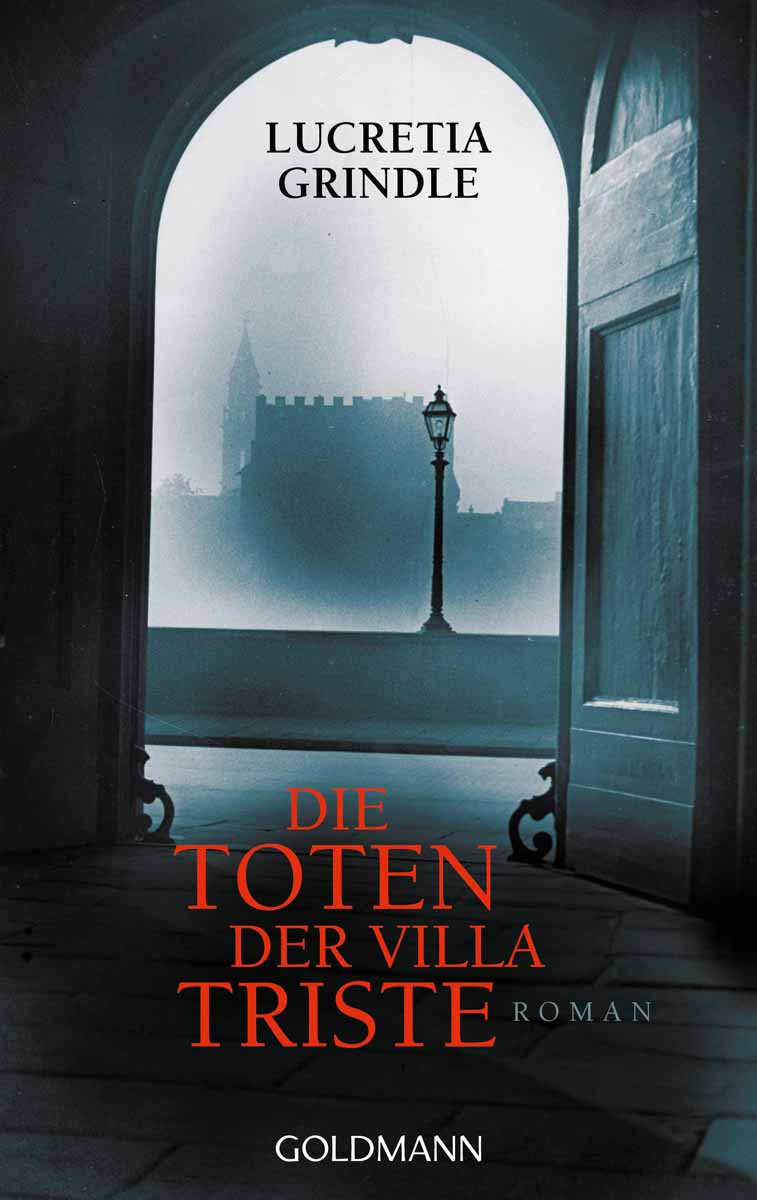![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
offizielle Unterlagen … verwechselt.«
Seine Wortwahl ließ sie lächeln.
»Sehr diplomatisch, Ispettore. Verwechselt ist sehr höflich ausgedrückt. Verschlampt trifft es besser. Oder in vielen Fällen vernichtet.«
»Es wäre also nicht ungewöhnlich, wenn beispielsweise eine Geburtsurkunde verloren gegangen wäre?«
»Ganz im Gegenteil. Geboren, gestorben, verheiratet, getauft. In vielen Fällen gab es keine Unterlagen mehr, dass jemand irgendwas davon durchgemacht hatte.«
»Aber es ist Ihnen trotzdem gelungen, die Verwandten der Partisanen ausfindig zu machen?«
»Nun ja«, bestätigte sie, »zumindest in vielen Fällen. Wir werteten damals alle noch verfügbaren Unterlagen aus. Und ja, wir haben uns oft auf mündliche Auskünfte verlassen. Auf Briefe, die nach Hause geschickt worden waren, auf Berichte von Kameraden oder Kommandeuren – alles Mögliche. Trotz alledem«, seufzte sie, »würde ich nicht vor Überraschung vom Stuhl fallen, wenn wir das eine oder andere Buch und so manches Paar Socken für Kinder gekauft hätten, deren Eltern sich nicht wirklich heldenhaft verhalten haben. Aber was diesen Mann angeht – wenn er aus dem Süden stammt, lebte er damals hinter den Linien der Alliierten. Falls er mit den Partisanen gekämpft hat, dann nicht in seiner Heimat. Wie gesagt, wir befassen uns fast ausschließlich mit den Angehörigen von Partisanen, die aus dieser Gegend stammen. Es gibt woanders ähnliche Organisationen. Eine leistet in Turin exzellente Arbeit – im Piemont war man natürlich sehr aktiv. In Padua gibt es eine weitere.«
Sie griff nach einem Füllfederhalter, schraubte den Deckel ab, legte ihn dann wieder ab und ballte mehrmals hintereinander die Hand zur Faust. »Arthritis«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Wirklich ermüdend. Ich nehme an, darüber brauchen Sie sich noch keine Gedanken zu machen.« Ehe Pallioti etwas darauf erwidern konnte, griff sie erneut nach dem Stift und zog dann einen Notizblock heran. Während sie schrieb, sagte sie: »Ich kenne die Leiter der Organisationen in Turin und Padua persönlich. Bestimmt werden sie Ihnen gern weiterhelfen.«
»Ich weiß leider nicht«, gestand Pallioti, »wo Roblino damals aktiv war.«
Signora Grandolo hielt inne und sah auf. »Sie meinen, Sie halten es für möglich, dass er damals in Florenz war?«
Pallioti nickte. »Vielleicht ist er mit mindestens einem Partisan von hier in Verbindung geblieben. Also, ja, ich halte das für möglich.«
»Also, in diesem Fall«, sagte sie, »sollten wir nachsehen.« Sie wandte sich ihrem Computer zu. »Nachdem Sie mich und nicht den Mann selbst fragen, gehe ich davon aus, dass Signor Roblino nicht mehr unter uns weilt?«
Es überraschte ihn nicht, dass sie offenbar keine Boulevardblätter las, die auch heute Morgen darüber berichtet hatten. Pallioti schüttelte den Kopf.
»Leider nein.«
Im Gegensatz zu dem Schlachtschiff auf Graziella Lombardis Schreibtisch war Signora Grandolos Computer schlank und silbern und sah aus, als wöge er höchstens ein Pfund. Sie tippte kurz auf der Tastatur herum und starrte dann auf den Bildschirm. Von seinem Platz aus konnte Pallioti nicht erkennen, was darauf zu sehen war. Jedenfalls ließ es sie die Stirn runzeln.
»Neeein«, erklärte sie gedehnt, während sie mit dem Finger langsam am Computerrand abwärtsstrich. »Roberto. Robbicci. Robeno. Aber kein Roblino. Nein, tut mir leid. Bei uns ist niemand mit diesem Namen verzeichnet. Natürlich«, sie sah ihn über die Brille hinweg an, »könnte ich mich für Sie umhören, wenn Sie das möchten. Sie benachrichtigen, falls sich irgendwas ergibt. Wenn er hier«, sie tippte auf den Computer, »nicht auftaucht, bezweifle ich allerdings, dass wir etwas finden. Graziella hält unsere Dateien fortwährend auf dem neuesten Stand.«
Das überraschte Pallioti nicht sonderlich. Trantemento und Roblino hätten sich überall kennenlernen können. Vielleicht in einem Netzwerk für ehemalige Partisanen – schließlich deuteten die Erinnerungsstücke, die Giovanni Trantemento aufbewahrt hatte, darauf hin, dass er nicht ganz und gar mit der Vergangenheit abgeschlossen hatte –, oder sie waren sich zum ersten Mal in Rom während der Feiern zum sechzigsten Jahrestag begegnet. Oder Dr. Sachs hatte ihn angelogen. Eigentlich fühlte sich Pallioti, statt enttäuscht zu sein, eher bestätigt.
»Verzeihen Sie«, sagte er und rätselte gleichzeitig, ob er damit nicht zu weit ging, »ich möchte Ihnen nicht die Zeit
Weitere Kostenlose Bücher