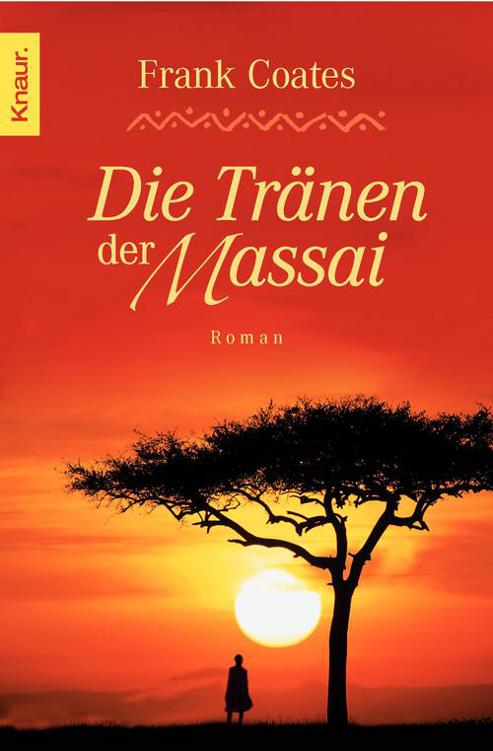![Die Tränen der Massai]()
Die Tränen der Massai
betrachtete.
»Dein Prisma hat heute Abend für uns einen Zauber gewirkt«, sagte er.
»Ja. Aber es ist nicht allein Massaimagie. Der Sonnenstein hat einmal dir gehört.«
»Mir?«
»Ja. Du warst der ungeschickte
Mzungu,
der mich mit seinem Pferd umgerannt hat.« Ihr Lächeln war weder spöttisch noch anklagend, sondern einfach nur gelassen, ebenso wie ihr Blick. »Und du warst derjenige, der mir dieses kostbare Geschenk gegeben hat.«
»Das Ding kam mir tatsächlich irgendwie bekannt vor. Aber das war vor Jahren. Eine kleine Rotznase … du!«
»Selbstverständlich ich. Und ich habe es behalten, um mich stets an deine Freundlichkeit zu erinnern.«
»Aber ich bin hier. Du brauchst keinen billigen Nippes, um dich an mich zu erinnern.«
»Ja, du bist hier. Aber das wird nicht immer so sein. Eines Tages …« Sie hielt das Prisma in der Hand und berührte damit ihre Lippen, bevor sie es an seine hielt. »Ronald Colvan«, sagte sie. »Du und dieser Augenblick, ihr seid für immer in meinem Sonnenstein gefangen.« Sie bewegte das Prisma rund um sein Gesicht, berührte seine Augen, fuhr damit über seine Nase, rollte es über seine Wange und drückte es an seine Lippen. »Dieses Bild, das ich von dir habe, ist nun im Stein. Wenn du mich verlässt und wenn ich mich nach dir sehne, kann ich dich aus dem Stein zu mir zurückholen.«
Ihre Augen glitzerten im Mondlicht. »Du wirst für immer in diesem Stein und bei mir sein.«
Kapitel 7
Aus Peabodys Ostafrikaführer (5. Auflage):
Während des Notstands war es Aufgabe der Home Guard, die Mau-Mau-Organisation durch ihr Netz von Sund durch Strafmaßnahmen zu unterminieren und zu neutralisieren.
Korruption und Anwendung von Folter erreichten in der Home Guard skandalöse Ausmaße, und sowohl weiße Kolonialtruppen als auch Eingeborene machten sich der Brutalität gegen Zivilisten schuldig.
1955 wurde eine Amnestie erlassen, um Mau-Mau-Guerillas dazu zu bringen, sich zu ergeben, aber sie schützte auch die Home Guard von weiterer Verfolgung.
I m Thorn Tree Café ging es wie immer sehr geschäftig zu. Die Mittagsgäste drängten sich am Eingang, einige wollten zahlen, andere versuchten, die Aufmerksamkeit des Kellners zu erregen, damit er ihnen einen Tisch zuwies.
Mengoru schob sich an ihnen vorbei und bahnte sich durch das Gedränge einen Weg zu einem Tisch in der Ecke, von dem aus man die Kimathi Street sehen konnte. Er quetschte sich auf die Bank; sein umfangreicher Bauch hob den Tisch ein wenig an, so dass der Salzstreuer umfiel und die Zuckerschale wackelte. Noch bevor er saß, schnippte er mit den Fingern und rief nach einem Bier.
Mengorus kräftiger Körperbau stand im Widerspruch zu seiner Massaiherkunft. Sein Stamm betrachtete ihn als Massai, und in seinem Herzen fühlte er sich wie einer, aber sein Großvater hatte bei einem Überfall eine junge Kikuyufrau gestohlen, und sie war Mengorus Großmutter geworden. Seine Kikuyu-Seite zeigte sich in den dickeren Armen und Beinen und in dem beträchtlichen Bauch, obwohl das auch vom guten kenianischen Bier kommen konnte, das er in größeren Mengen konsumierte. Seine Nase hatte die Biegung der Massainasen, war aber am unteren Ende breiter und dicker. Seine Stirn über den buschigen Brauen war ständig gerunzelt, was ihm zusammen mit der Nase einen falkenartigen Ausdruck verlieh. Er war einen Kopf kleiner als der durchschnittliche Massai, und auch das hatte er seiner Großmutter zu verdanken.
Sein Großvater war von seiner Kikuyu-Trophäe entzückt gewesen und hatte die Verbindung schließlich mit einer Massaihochzeit offiziell gemacht. Zur Belohnung für ihre schwere Arbeit und weil sie so treu alles getan hatte, was man von einer guten Massaifrau erwartete, hatte man Mengorus Großmutter erlaubt, die Verbindung zu ihrem Stamm wieder aufzunehmen. Also war Mengoru bei den Kikuyu als Halbkikuyu und bei den Massai als vollständiger Massai anerkannt. Es war eine Situation, die ihm sehr gefiel. Und da der Anführer im Kampf um die Unabhängigkeit, Jomo Kenyatta, behauptet hatte, irgendwo in seiner obskuren Abstammung auch eine Massaiverbindung zu haben, war Mengoru der Ansicht, dass er sich in guter Gesellschaft befand.
Er sah sich um und war erfreut, festzustellen, dass der junge Onditi noch nicht da war. Er würde also Zeit haben, ein Bier oder zwei zu trinken, ohne sich verpflichtet zu fühlen, Onditi eines anzubieten. Er war überrascht, dass der junge Mann, immerhin ein Neffe von Nicholas Onditi,
Weitere Kostenlose Bücher