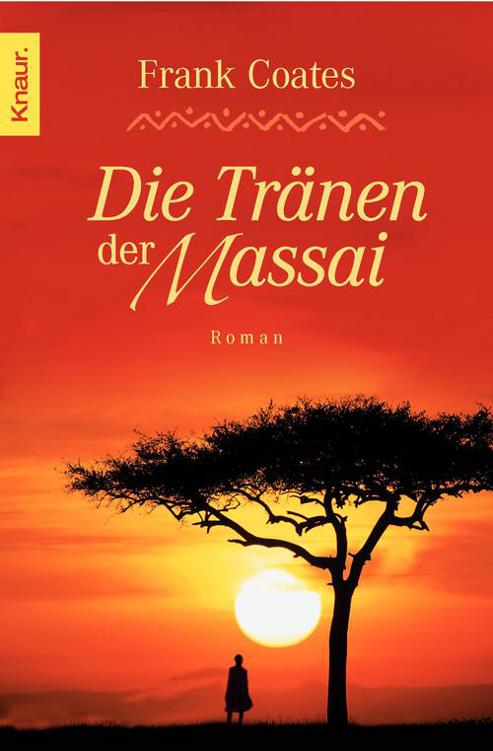![Die Tränen der Massai]()
Die Tränen der Massai
machen? Alles an Onditi beunruhigt mich. Er ist so leicht durchschaubar. Ich kann kaum glauben, dass er gestern in unser Büro gekommen ist. Wozu braucht er meine Privatadresse?«
»Haki ya Mungu,
Malaika. Ich hätte dir das lieber nicht sagen sollen. Jetzt machst du dir noch mehr Gedanken. Aber er wird nicht noch einmal fragen. Ich habe ihn weggescheucht. Ja, er hat Angst vor mir.«
David hatte sich, kurz nachdem er für ein Jahr ins Büro gekommen war, zu Malaikas persönlichem Beschützer ernannt. Er hatte direkt nach dem College bei AmericAid angefangen, und Malaika hatte ihn unter ihre Fittiche genommen, bis er sich zurechtgefunden hatte. Nachdem sie ihm und seiner jungen Freundin auch noch durch eine schwierige Zeit nach einer Fehlgeburt geholfen hatte, war er ihr ewig dankbar. Aber sie bezweifelte, dass selbst seine leidenschaftliche Loyalität gegen James Onditis Überlegenheit ankommen konnte. »Danke, David«, sagte sie lächelnd. »Aber es ist mehr als das. Ich kann keines meiner Projekte umsetzen, bevor sie von Onditi autorisiert wurden.«
»Sasa,
also machst du es folgendermaßen. Du gehst zu Mr. Kibera und sagst: ›Mr. Kibera, es ist nicht meine Schuld, dass ich Schwierigkeiten mit meiner Arbeit habe. Es ist dieser böse Mann, Mr. Onditi, der neckische Spielchen mit mir spielt.‹«
Malaika lächelte trotz der ernsten Situation. »Neckische Spielchen« – näher würde ein guter Methodist wie David Livingstone Shakombo der Beschreibung sexueller Belästigung nicht kommen. Aber sie nahm an, dass selbst David wusste, wie unrealistisch dieser Rat war. Sie konnte nicht zu Joe Kibera gehen und sich über Onditi beschweren. Joe war von der alten Schule: Man erwartete von afrikanischen Frauen, dass sie mit solchen Dingen zurechtkamen. Männer waren nun einmal so.
Und als wäre ein schlechter Traum Wahrheit geworden, sah Malaika in diesem Augenblick James Onditi, der sich durch die Menge der Straßenhändler und Kunden, Touristen und Betenden schob. Er hatte sie noch nicht entdeckt. Es war noch Zeit, zu fliehen. Malaika griff nach ihrem
Chondo,
den sie ans Stuhlbein gebunden hatte. Dann hielt sie inne und richtete sich langsam wieder auf. Sie legte beide Hände auf die Tischplatte und verschränkte die Finger. Sie würde sich von Männern wie James Onditi nicht bei einem Mittagessen mit einem Freund stören lassen.
Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Onditi am Rinnstein ganz in der Nähe ihres Tischs stehen blieb. Sie hielt den Atem an. David war vollkommen darauf konzentriert, die letzten Essensreste mit seinem Löffel einzufangen.
»Jambo«,
sagte Onditi nun direkt neben ihr. »Ms. Kidongi.« Er zischte die westliche Anrede heraus. »Ich sehe, Sie essen am einfacheren Ende der Stadt«, höhnte er. »Wie geht es Ihnen heute, meine Liebe?
Habari ako?«
»Es geht ihr gut«, fauchte David und plusterte sich auf.
Onditi ignorierte ihn und richtete weiterhin den Blick auf Malaika, bis ihre Wangen glühten. »Ich habe Sie seit einiger Zeit nicht mehr im Büro gesehen. Macht AmericAid Pause? Keine Projekte? Was ist mit dem in Tsavo? Nein, warten Sie, es war Machakos, nicht wahr?«
»Sie haben die Papiere immer noch«, erwiderte Malaika und weigerte sich, ihn anzuschauen.
»Tatsächlich? Dann muss ich sie übersehen haben. Warum kommen Sie nicht vorbei, und wir sprechen noch einmal darüber?«
Malaika schob ihren Stuhl zurück. »Komm, David«, sagte sie. »Es ist Zeit, zu gehen.«
»Ja, kommen Sie nicht zu spät. So viel zu tun!« Onditi lachte in Davids Gesicht, als dieser aufstand. »Oh! Mr. Shakombo! Tut mir Leid. Ich hab Sie überhaupt nicht gesehen. Aber Sie müssen sich beeilen.«
David richtete sich in dem Versuch, auf Augenhöhe mit Onditi zu gelangen, so gerade wie möglich auf, aber es half nichts. »Ja«, sagte er mit so viel Würde, wie er aufbringen konnte. »Wir gehen.«
Onditis Lachen ging im Klang des Lautsprechers der nahen Jamia-Moschee unter, als zum Gebet gerufen wurde.
Jack genoss den Kaffee an Idis Stand auf dem Bürgersteig und die Wärme der Morgensonne, die ihre größte Kraft noch nicht entwickelt hatte, und, was wichtiger war, er hatte kein schlechtes Gewissen, weil er sich dieses kleine Vergnügen leistete. Seit er vor zwei Wochen aus Kisumu zurückgekehrt war, war er unfähig gewesen, irgendetwas zu genießen, weil er immer wieder an das tote Mädchen in Kericho denken musste, was jede Freude vertrieb, weil er das Gefühl hatte, Annehmlichkeiten nicht verdient zu
Weitere Kostenlose Bücher