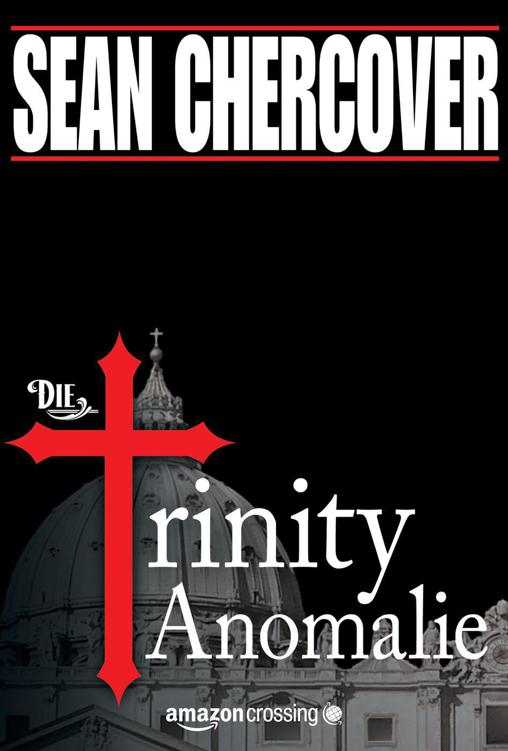![Die Trinity-Anomalie (German Edition)]()
Die Trinity-Anomalie (German Edition)
sie. »Das haben Sie mir im Traum ans Herz gelegt.« Ihr Lächeln wurde wärmer. »Ich habe es nicht vergessen und Sie hoffentlich auch nicht.«
Die Bürgersteige waren so überfüllt wie zur Stoßzeit in Manhattan. Die Polizei hielt die Leute zwar an weiterzugehen, aber da man sich schließlich im Süden befand, schlurften sie in einem Tempo dahin, das jeden New Yorker zur Weißglut getrieben hätte.
Die Sonne ging langsam unter, aber allein die vielen Menschen erzeugten so viel Hitze, dass es immer noch um die fünfunddreißig Grad war. Dabei konnte Daniel nicht einmal seine Windjacke ausziehen, da man sonst seine Waffe gesehen hätte. Also drängte und schwitzte er sich weiter durch die Massen, um möglichst schnell aus dem French Quarter zu entkommen.
Er machte kurz im Everything Shoppe auf der Canal Street halt und genoss die Klimaanlage, während er ein paar Besorgungen machte: Sandwiches und Zapp’s-Chips fürs Abendessen, Zigaretten für Trinity, eine Flasche Rotwein und für den nächsten Morgen Energydrinks. Als er mit seinen Einkäufen wieder hinausging, schlug ihm die Hitze wie ein nasses Handtuch ins Gesicht.
Dann fiel ihm ein Mann auf, der aus der Menge herausstach. Daniel blieb unter einer Zwergpalme stehen und beobachtete ihn. Der Mann war Ende sechzig, hatte schütteres Haar, aber hielt sich aufrecht und trug einen englischen Maßanzug, der sicher seine achttausend Dollar gekostet hatte, aber sich sehr schlicht gab. Er stand vor einem schwarz-silbernen Rolls-Royce Phantom mit laufendem Motor.
Der Mann kam näher, und Daniel bekam einen Hauch seines Eau de Cologne in die Nase. Es roch nach altem Geldadel. Er wirkte wie jemand ›aus gutem Hause‹, wie manche das noch immer nannten. Er sagte: »Glückwunsch. Sie haben den Weg eingehalten und ich glaube, bald werden Sie die Wahrheit erfahren.«
Sie haben den Weg eingehalten … bald werden Sie die Wahrheit erfahren.
Die Worte klangen in Daniels Ohr nach wie ein Echo.
Beschreite den Weg und finde die Wahrheit.
Die Nachricht, die für ihn im Westin Hotel hinterlegt worden war. Eine elegante Handschrift auf teurem Papier.
»Papa Legba, nehme ich an.«
Der Mann lächelte. »Richtig.« Er zeigte auf den Rolls. »Erlauben Sie mir, dass ich Sie zurück nach Saint Sebastian’s bringe. Im Wagen ist es schön kühl und unterwegs können wir uns unterhalten. Die Jacke ist sicher furchtbar warm.«
Der Mann goss dreißig Jahre alten Macallan Single Malt in zwei Kristallgläser, reichte eines Daniel und lehnte sich in seinem grünen Ledersitz zurück, während der Rolls-Royce sich sanft schaukelnd in Bewegung setzte. Er sagte: »Sie haben uns sehr beeindruckt, Daniel. Sie haben bewiesen, dass Sie das Zeug zu einem Topagenten haben.« Seinen Akzent konnte Daniel einfach nicht einordnen. Wahrscheinlich ein Amerikaner, der lange Zeit in England und ein paar Jahre auf dem europäischen Festland gelebt hatte. Oder er war ein Brite, der vor Jahrzehnten nach Amerika ausgewandert war und den Oberschichtakzent seiner Jugend bewusst abgelegt hatte.
»Wer ist ›wir‹?«, fragte Daniel. »Und wer zum Teufel sind
Sie
überhaupt? Papa Legba hat sicher was dagegen, dass man seinen Namen missbraucht.«
Das Lächeln des Mannes strahlte ungeheures Selbstbewusstsein aus. Bei einem Jüngeren hätte es arrogant gewirkt, aber bei ihm war es nur äußeres Zeichen der überlegenen Gelassenheit, die ein langes, erfahrungsreiches Leben mit sich bringt. »Wir sind eine Organisation, von der Sie noch nie gehört haben: die Fleur-de-Lis-Stiftung. Und ich bin Carter Ames, ihr Geschäftsführer. Wie Sie bereits wissen, waren wir von Anfang an Ihre Verbündeten.«
Daniel probierte den Scotch. Er war wie flüssige Seide. »Warum? Welche Interessen verfolgen Sie?«
»Das Ziel unserer Stiftung ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen, damit die Menschen fundierte Entscheidungen über die Zukunft unserer Zivilisation machen können«, sagte Carter Ames. »Leider gibt es eine andere Organisation, ebenso mächtig wie wir, die den Menschen die Wahrheit nicht anvertrauen will. Also bekämpfen wir einander. Wir spielen dieses Spiel schon lange, und vielleicht wird es niemals enden. Aber wir müssen es weiterspielen, damit wir unsere Freiheit nicht vollends einbüßen.«
»Hat die auch einen Namen, diese mächtige Organisation, die Sie bekämpfen?«
»Allerdings, sie nennt sich ›Rat für den Weltfrieden‹, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen.« Er nahm einen Schluck Scotch.
Weitere Kostenlose Bücher