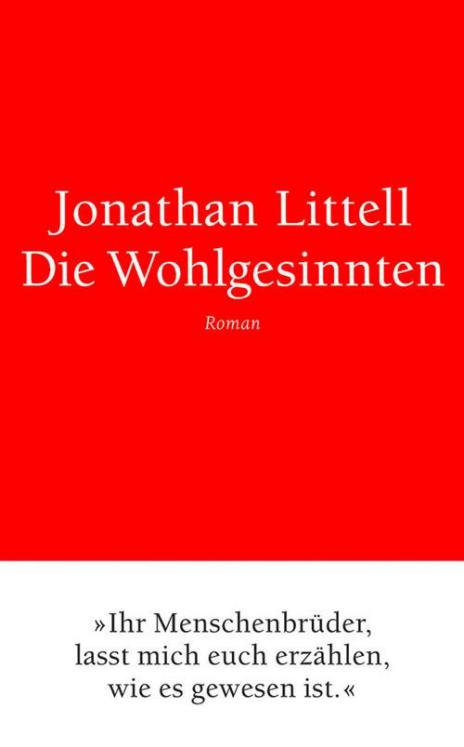![Die Wohlgesinnten]()
Die Wohlgesinnten
Ausführung war annehmbar, ohne Überraschungen: Nur der Cellist war ungewöhnlich begabt. Eichmann spielte bedächtig, methodisch, den Blick fest auf die Noten gerichtet; er machte keine Fehler, schien aber nicht zu begreifen, dass das nicht genügte. Das erinnerte mich an seine Bemerkung vom Vortag: »Boll spielt besser als ich, und Heydrich spielte noch besser.« Vielleicht verstand er es letztlich doch und akzeptierte seine Grenzen, indem er sich an dem Wenigen, das ihm gelang, erfreute.
Ich applaudierte lebhaft; Frau Eichmann schien besonders geschmeichelt. »Ich bringe die Kinder zu Bett«, sagte sie. »Anschließend gehen wir zu Tisch.« Wir nahmen noch ein Glas und warteten: Die Frauen unterhielten sich über die Rationierung und die Gerüchte, die Männer über die neuesten Nachrichten, die wenig interessant waren, weil die Front stabil war und sich kaum etwas getan hatte seit dem Fall von Tunis. Die Stimmung war ungezwungen, gemütlich auf österreichische Art, ein bisschen übertrieben. Dann bat Eichmann uns ins Esszimmer. Er wies uns selbst die Plätze an, mir den Platz rechts von ihm, am Kopfende des Tisches. Er entkorkte einige Flaschen Rheinwein, und Vera Eichmann trug einen Braten mit Wacholderbeersoße und grünen Bohnen auf. Eine angenehme Abwechslung nach der ungenießbaren Küche von Frau Gutknecht und auch der normalen Kantinenkost des SS-Hauses. »Köstlich«, versicherte ich Frau Eichmann. »Sie sind eine unübertreffliche Köchin.« – »Oh, ich habe Glück gehabt. Dolfi gelingt es häufig, selten gewordene Lebensmittel aufzutreiben. Die Läden sind fast leer.« In angeregter Stimmung ließ ich mich zu einem boshaften Porträt meiner Vermieterin hinreißen, wobei ich mit ihren Kochkünsten begann und dann ihre anderen Eigenheiten aufs Korn nahm. »Stalingrad?«, sagte ich, ihren Dialekt und ihre Stimme nachahmend. »Was haben Sie bloß da unten zu suchen gehabt? Hier sind wir doch gut aufgehoben, oder? Außerdem, wo liegt das eigentlich?« Eichmann lachte und verschluckte sich an seinem Wein. Ich fuhr fort: »Eines Tages, am Morgen, bin ich zur gleichen Zeit aus dem Haus gegangen wie sie. Wir kamen an einem Sternträger vorbei, vermutlich einem privilegierten Mischling . Und sie rief aus: Oh! Sehen Se nur, Herr Offizier, ein Jude! Haben Se den noch nicht vergast? « Alles lachte, Eichmann hatte Tränen in den Augen und verbarg das Gesicht in der Serviette. Nur Frau Eichmann blieb ernst: Als ich das bemerkte, hielt ich inne. Sie schien eine Frage stellenzu wollen, besann sich dann aber. Um die Fassung wiederzugewinnen, schenkte ich Eichmann nach: »Kommen Sie, trinken Sie einen Schluck!« Er lachte immer noch. Die Unterhaltung wandte sich anderen Themen zu, und ich aß; einer der Gäste erzählte eine komische Geschichte über Göring. Eichmann setzte eine ernste Miene auf und wandte sich an mich: »Sturmbannführer Aue, Sie haben doch studiert. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, eine ernsthafte Frage.« Ich bedeutete ihm mit meiner Gabel fortzufahren. »Ich nehme an, Sie haben Kant gelesen? Ich lese gerade«, fuhr er fort und rieb sich die Lippen, »die Kritik der praktischen Vernunft . Natürlich, ein Mann wie ich, ohne Hochschulbildung, meine ich, kann nicht alles begreifen. Trotzdem, einiges verstehe ich. Und ich habe viel nachgedacht, vor allem über die Frage des kategorischen Imperativs. Sie sind bestimmt wie ich der Meinung, dass jeder anständige Mensch gemäß diesem Imperativ leben muss.« Ich trank einen Schluck Wein und stimmte ihm zu. Eichmann fuhr fort: »Der Imperativ, so wie ich ihn verstehe, besagt: Die Maxime meines eigenen Willens soll so sein, dass sie zum Prinzip des Sittengesetzes werden kann. Durch sein Handeln setzt der Mensch Recht.« Ich wischte mir den Mund ab: »Ich glaube, ich verstehe, worauf Sie hinauswollen. Sie fragen sich, ob unsere Arbeit mit dem kategorischen Imperativ in Einklang steht.« – »Nicht ganz. Aber einer meiner Freunde, der sich auch für Fragen dieser Art interessiert, behauptet, in Kriegszeiten, wenn Sie so wollen, aufgrund der durch die Gefahr heraufbeschworenen Ausnahmesituation, sei der kategorische Imperativ aufgehoben, weil man natürlich nicht wünscht, dass der Feind einem das, was man ihm zufügt, auch zufügt, und daher kann das, was wir tun, nicht zur Grundlage eines allgemeinen Rechts werden. Wohlgemerkt, das ist seine Meinung. Ich finde, dass er Unrecht hat und dass unsere Pflichterfüllung, in gewisser Weise, durch Befolgung
Weitere Kostenlose Bücher