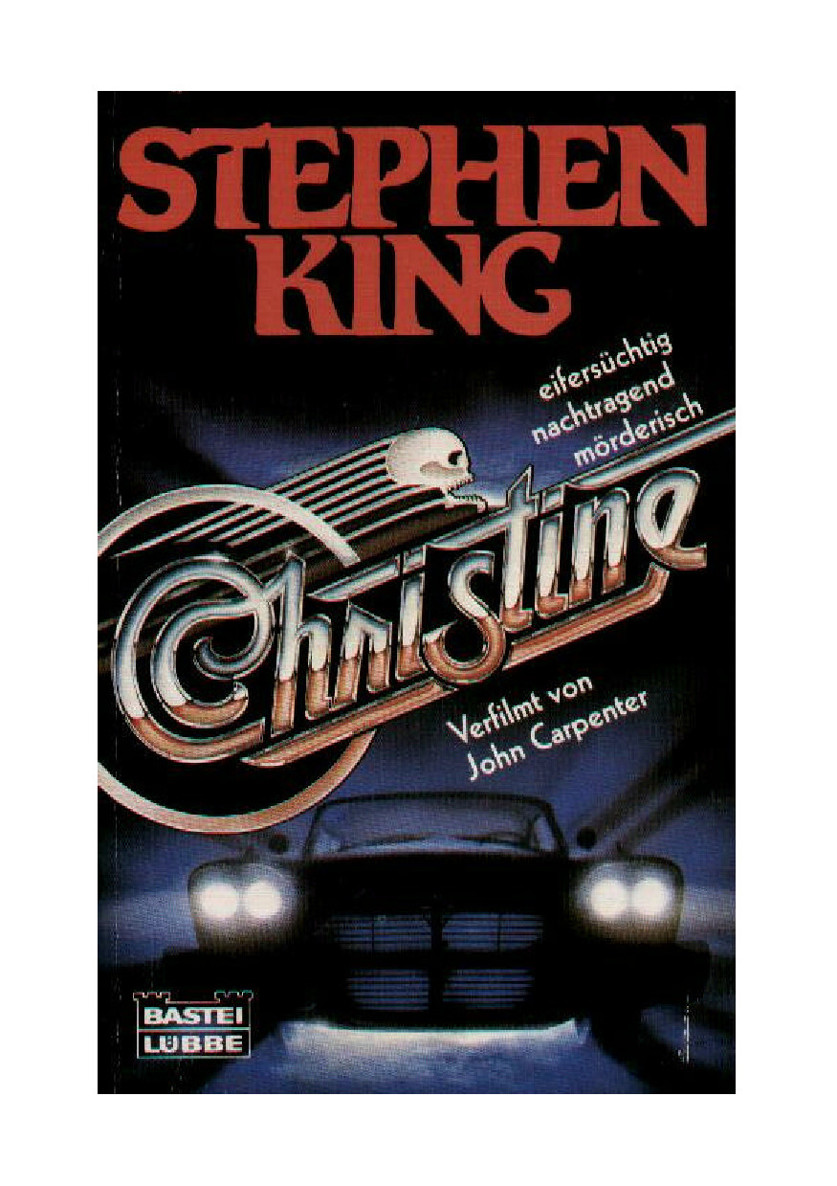![Dokument1]()
Dokument1
dunkler.
Schließlich blickte ich träge hoch und sah, daß die Luft draußen voller Blut war. Aber es war kein Blut… es war ein pulsierendes Rotlicht, das von den wirbelnden Schneeflocken reflektiert wurde. Leute schlugen von draußen gegen die Tür.
»Ist es jetzt gut genug?« fragte mich Leigh.
Ich blickte auf Christine - nur war es jetzt keine Christine mehr. Es war ein plattgetretener, weitverstreuter Haufen aus verbogenen Metallstücken und zertrampeltem Blech, aus Pol-sterflocken und Stoff-Fetzen und glitzernden Glassplittern.
»Es muß reichen«, sagte ich. »Laß sie herein, Leigh.«
Und während sie zur Tür ging, verlor ich abermals die Besinnung.
Dann eine konfuse Serie von Bildern; Dinge, die für eine Weile deutlich ins Blickfeld rückten und verblaßten oder sich vollkommen auflösten. Ich kann mich an eine Tragbahre erinnern, die aus einem Krankenwagen gehoben wurde. Ich kann mich erinnern, wie die Rollenstützen aus Chrom heruntergeklappt wurden und wie sich das Licht der Neonröhren an der Hallen-decke in dem Metall spiegelte. Ich kann mich erinnern, wie jemand sagte: »Schneiden! Aufschneiden, damit wir uns das Bein wenigstens anschauen können«; ich kann mich erinnern, wie jemand anderer - Leigh, glaube ich - sagte: »Bitte, tun Sie ihm nicht weh, tun Sie ihm nicht weh, wenn es irgendwie geht«; ich kann mich auch an den Wagenhimmel der Ambulanz erinnern… es mußte eine Ambulanz gewesen sein, denn am Rand meines Gesichtsfeldes hingen zwei mit Schläuchen ver-bundene Flaschen; ich kann mich an die kühlende Wirkung eines antiseptischen Wattebauschs auf meiner Haut erinnern, und dann an den Stich einer Nadel.
Danach wurden die Dinge erheblich verworrener. Ich wußte, irgend etwas tief in mir wußte, daß ich nicht träumte - der Schmerz bewies das, wenn es auch sonst keinen Beweis gab -, aber alles schien für mich nur ein Traum zu sein, weil es so unheimlich war. Ich war offensichtlich vollgepumpt mit Drogen, und auch das trug dazu bei… aber auch der Schock, unter dem ich noch litt. Nichts beschönigen, Dennis! Meine Mutter war da und weinte in einem Zimmer, das dem Krankenzimmer deprimierend ähnlich sah, in dem ich den ganzen Herbst verbracht hatte. Dann war mein Vater da, und Leighs Dad stand neben ihm. Sie machten beide so bitter ernste und grimmige Gesichter, daß sie aussahen wie Dideldum und Dideldei, wenn Franz Kafka über sie geschrieben hätte. Mein Vater beugte sich über mich und sagte mit einer Stimme, die wie Donner auf einer Schicht Watte widerhallte: »Wie ist Michael dorthin gekommen, Dennis?« Das war, was sie von mir wissen wollten: wie Michael dorthin gekommen war. Oh, dachte ich, Freunde, ich könnte euch Geschichten erzählen…
Dann sagte Mr. Cabot: »In was hast du meine Tochter hineingezogen, Junge?« Ich scheine mich noch an meine Antwort erinnern zu können: »Es geht nicht darum, in was ich sie hineingezogen habe, sondern darum, aus was Leigh Sie herausgehalten hat«; was ich unter diesen Umständen noch für eine recht geistreiche Antwort halte, bei dem Zeug, mit dem sie mich inzwischen vollgepumpt hatten.
Elaine war kurz da, und sie schien mich mit einem Schokoriegel oder mit einer Käsestange ärgern zu wollen, die sie so weit weghielt, daß ich sie nicht erreichen konnte. Dann war Leigh da, die mir ein hauchdünnes Nylontuch vor das Gesicht hielt und mich bat, den Arm hochzuheben, damit sie es dort festbin-den konnte. Aber ich konnte meinen Arm nicht heben; er war so schwer wie ein Bleibarren.
Und dann war Arnie da, und das mußte natürlich ein Traum sein.
Vielen Dank, Mann, sagte er, und ich bemerkte mit jähem Erschrecken, daß das linke Glas seiner Brille zerschmettert war.
Sein Gesicht war okay, aber dieses zerborstene Brillenglas…
das machte mir Angst. Vielen Dank. Du hast es richtig gemacht. Ich fühle mich jetzt besser. Ich glaube, die Dinge werden jetzt wieder okay sein.
Nichts zu danken, Arnie, sagte ich - oder versuchte, es zu sagen… aber da war er schon wieder weg.
Es war am nächsten Tag - nicht der zwanzigste, sondern Sonntag, der einundzwanzigste Januar -, als ich anfing, wieder ein bißchen normal zu werden. Mein linkes Bein war eingegipst und schwebte in einer mir bereits vertrauten Position inmitten von Gewichten und Flaschenzügen. Da saß ein Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, links neben dem Bett auf einem Stuhl und las in einem Taschenbuch von John D. MacDonald.
Er bemerkte, daß ich ihn ansah, und ließ das
Weitere Kostenlose Bücher