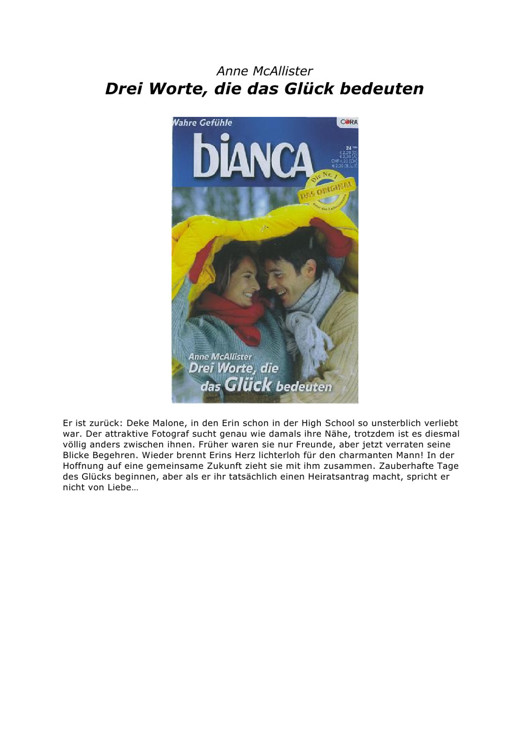![Drei Worte, die das Glueck bedeuten]()
Drei Worte, die das Glueck bedeuten
Wissen, dass er dieses Gefühl immer noch nicht erwiderte, war für sie unerträglich. Das Einzige, was sie noch herausbrachte, waren die Worte: „Das ist alles?“
„Alles?“ Nun war es an Deke, sie entgeistert anzustarren. Dann wurde er unruhig. Er zögerte, knetete seine Hände, zuckte mit den Schultern, fuhr sich durchs Haar. „Ich kann nicht…“, begann er, dann brach er ab.
Und er sprach die Worte nicht aus, die Erin sich so sehr von ihm wünschte.
„Gut“, sagte er schließlich. Er klang angespannt. „Vergiss es bitte. Entschuldige, dass ich überhaupt gefragt habe. Ich wollte dich damit wirklich nicht beleidigen.“
An seinem Kinn zuckte ein Muskel.
„Du hast mich nicht…“, begann sie ihm zu widersprechen, aber dann schossen ihr Tränen in die Augen, und ihr versagte die Stimme. Außerdem konnte sie ihn unmöglich anlügen und ihm sagen, dass er sie nicht beleidigt hatte.
Deke schob die Fäuste in die Hosentaschen. „Dann hat es auch keinen Sinn, dass wir noch weiter hier bleiben. Fröhliche Weihnachten. Wir reisen gleich morgen früh ab.“
Am nächsten Morgen brachen Deke und Zack tatsächlich auf. Deke hatte den Lieferwagen schon fertig gepackt und Zack angezogen, als die Kinder nach unten kamen.
„Was? Ihr fahrt jetzt weg?“ Sophie war bestürzt. „Das geht nicht!“ Tränen schossen ihr in die Augen.
„Ihr dürft nicht abreisen“, sagte Nico. „Wir brauchen euch hier!“
„Und ich dachte, du wolltest mir noch zeigen, wie man richtige Fotos macht“, protestierte Gabriel.
Deke nahm alle Einwände hin, ohne auch nur die geringste Gefühlsregung zu zeigen. „Wir müssen fahren, es geht nicht anders“, sagte er bloß. Dann schüttelte er Gabriel die Hand, küsste Sophie und umarmte Nicolas.
„Fahren?“ sagte Zack und schaute verwirrt drein.
Gabriel warf Erin einen herausfordernden Blick zu, als wollte er sie fragen, wodurch sie ihn vertrieben hatte.
Sie rieb sich die Handinnenflächen an den Jeans und erklärte: „Wir wussten doch alle, dass Deke eigentlich in New Mexico wohnt und dass er nicht ewig hier bleiben kann.“ Dabei betete sie, dass Deke ihr nicht widersprechen würde… und hoffte insgeheim, dass er es doch täte.
Natürlich widersprach er ihr nicht. Er schnallte Zack im Kindersitz an und warf Erin noch einen langen Blick zu, den sie nicht deuten konnte. Dann stieg er in den Wagen und fuhr davon.
In den letzten Monaten hatte Zack eine Menge neuer Wörter gelernt. Auf dem Weg nach Süden sagte er sie alle immer wieder vor sich hin.
„Gabbiel“, sagte er. „Sophie! Nico! Wo Nico? Gran’pa! Will Gran’pa!“ Doch noch viel öfter sagte er: „Hause. Will Mommy. Wo Mommy?“
Mommy.
An seine leibliche Mutter, Violet, hatte Zack gar keine bewusste Erinnerung.
Jedenfalls rief er jetzt nicht nach ihr. Nein, er sehnte sich nach der Frau, die Gabriel und Sophie und Nicolas Mommy nannten. Erin.
Die Frau, die er, Deke, liebte.
Die Frau, die ihn aber nicht liebte.
Denn wenn sie ihn liebte, hätte sie seinen Antrag doch angenommen, oder?
Wenn sie es für möglich gehalten hätte, jemals das für ihn zu empfinden, was sie für JeanYves empfunden hatte, hätte sie ihnen doch eine Chance gegeben?
Aber das hatte sie nicht getan.
Sie hatte Deke bloß zugehört und ihn dabei angestarrt, als wäre er vollkommen verrückt geworden, während er verzweifelt versuchte, sie mit allen guten Argumenten, die ihm einfielen, davon zu überzeugen, seine Frau zu werden. „Das ist alles?“ hatte sie bloß gesagt.
Ob das alles war? Nein, verdammt, das war es noch lange nicht. Er liebte sie.
Das hatte er ihr allerdings nicht gesagt, dazu hatte ihm der Mut gefehlt.
Und jetzt, je weiter er sich von Eimer entfernte, spürte er immer deutlicher, wie schmerzvoll es für ihn war, dieser Liebe den Rücken zu kehren. Und er wusste: Diesem Schmerz konnte er nicht entkommen. Er würde ihn immer mit sich nehmen.
Ich hätte es ihr sagen sollen, dachte Deke. Aber ich konnte es nicht.
Unruhig rutschte er auf dem Sitz hin und her. Er sah in den Rückspiegel und blickte sich dabei selbst in die Augen. Da erinnerte er sich an das letzte Mal, dass er in so ein Augenpaar geschaut hatte – das war auf dem Dachboden seines Elternhauses gewesen, als er John Malone angesehen hatte. Und erneut musste Deke feststellen, wie ähnlich er seinem Vater war. Nicht bloß äußerlich.
An Heiligabend hatte John ihm die Staffelei überreicht und ihm schließlich gesagt: „Du machst gute
Weitere Kostenlose Bücher