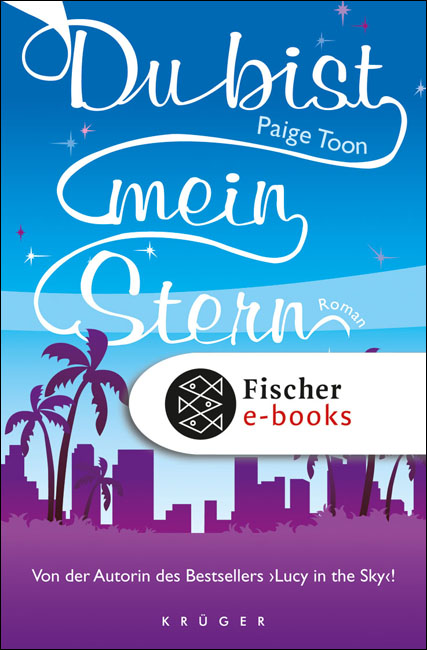![Du bist mein Stern]()
Du bist mein Stern
dass ich keine Lust hatte, wieder alles aufzuwühlen, indem ich ihn auf die Vergangenheit anspreche.«
»Kann ich verstehen«, sage ich. »Wann war denn das?«
»Vor ungefähr zwei Jahren.«
»Wow. So kurz ist das erst her? Na ja, wenigstens seit ihr jetzt wieder Freunde.«
»Ja. Er ist der einzige Mensch, dem ich wirklich vertraue.« Ich höre Traurigkeit in seiner Stimme.
»Ist er wirklich der einzige Mensch, dem du vertraust?« Ich kann es nicht glauben. Das ist bestimmt so was, was berühmte Menschen gerne mal behaupten. »Und was ist mit deiner Familie?«, frage ich. »Wo Blut doch dicker ist als Wasser und all das.«
»Ich hab keine Familie. Mein Dad war schon immer ein totaler Versager. Meine Mum ist tot. Meine Tante – die Schwester meiner Mutter – ist zwei Jahre vor meiner Mutter an Brustkrebs gestorben. Dad war ein Adoptivkind. Meine Großeltern sind schon lange tot. Ich kannte ohnehin nur die mütterlicherseits, weil Dad mit fünfzehn von zu Hause abgehauen ist. Und das ist es auch schon. Christian war für mich immer so was wie der Bruder, den ich nie hatte.«
Wir sitzen eine Weile schweigend da, während ich das alles auf mich wirken lasse. Ich empfinde ein starkes Mitgefühl.
»Ach, scheiß drauf«, sagt er plötzlich. »Was machst du da überhaupt, mich dahin zu bringen, über diesen ganzen Mist zu reden. Komm!« Er steht auf und reckt sich, während er auf die Stadt schaut. Ich erhebe mich. Ich würde gern etwas Tröstendes sagen, aber ich finde keine Worte. Also gehen wir schließlich schweigend zurück zu seinem Motorrad, und er fährt uns nach Hause.
Kapitel 11
Am nächsten Morgen bleibe ich noch eine Weile im Bett liegen und denke über die Ereignisse der letzten Nacht nach. Meine Gefühle für Johnny haben sich verändert, nachdem er sich mir geöffnet hat, und ich glaube, im Moment möchte ich nichts mehr, als dass er mir ebenso vertraut wie Christian. Ich möchte mich ihm näher fühlen. Inzwischen ist da mehr als bloß eine oberflächliche körperliche Anziehung. Mir liegt wirklich etwas an ihm. Und ich möchte ihn heute unbedingt sehen.
Als ich nach unten ins Büro gehe, fühle ich mich wie in einem Traum und kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Der Anruf eines Journalisten reißt mich aus diesem Zustand. Er möchte wissen, mit wem Johnny gestern Abend im Ivy war. Ich lache und erkläre ihm, dass ich das war, nur seine P.A. Dass Johnny Lust auf eine Pizza hatte und Serengeti verreist ist, ich also einfach mitgegangen bin, um ihm Gesellschaft zu leisten. Das klingt für mich absolut unverfänglich, und ich hoffe, die Klatschkolumnisten sehen das auch so. Ich frage mich, was das Protokoll in so einem Fall vorsieht. Sollte ich eine Presseerklärung herausgeben oder warte ich, bis die Leute fragen? Ich google Johnny Jefferson und bin erstaunlich wenig darauf vorbereitet, im Internet Fotos von mir zu sehen, wie ich von seinem Motorrad steige. »Wer ist diese Frau?«, hat jemand geschrieben. Ich schlage mir vor Schreck die Hand vor den Mund und starre auf den Bildschirm.
»So schlimm?«
Mein Kopf schießt hoch und ich sehe ihn an. Plötzlich fühle ich mich ganz befangen.
Er kommt ins Büro und legt mir eine Hand auf die Schulter. »Alles in Ordnung, Nutmeg?«
»O ja, alles prima!«, antworte ich übertrieben enthusiastisch, weil ich versuche, mein Unbehagen zu verbergen. Ich bin froh, dass er sich an den Spitznamen erinnert, den er mir gegeben hat.
Er zieht sich in aller Ruhe einen Stuhl ran, und ich rücke ein Stück zur Seite. Er trägt mal wieder seine Designer-Sonnenbrille im Haus.
»Gib mal her«, sagt er.
Ich schiebe ihm die Maus rüber, und er fängt an, sich durch die Seite zu klicken. Als er das erste Foto sieht, das mich zeigt, wie ich hinter ihm her in das Restaurant gehe, lacht er.
»Du siehst aus wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht.« Er dreht sich zu mir und grinst, aber ich kann seine Augen hinter den dunklen Gläsern nicht sehen.
»Du mit deiner Sonnenbrille. Das ist doch albern«, sage ich ihm.
»Was?«
»Du. Weil du mit Sonnenbrille im Haus rumläufst.«
Er schiebt sie sich ins Haar. »So besser?«
»O Gott, nein, wenn ich diese blutunterlaufenen Augen so sehe … «, erwidere ich übertrieben affektiert.
Er schiebt die Sonnenbrille grinsend wieder auf seine Nase und surft weiter durch die Klatschseiten im Internet.
»Das ist so peinlich«, sage ich schließlich und stütze den Kopf in die Hände.
»Das sollte es aber nicht«, erwidert er.
Weitere Kostenlose Bücher