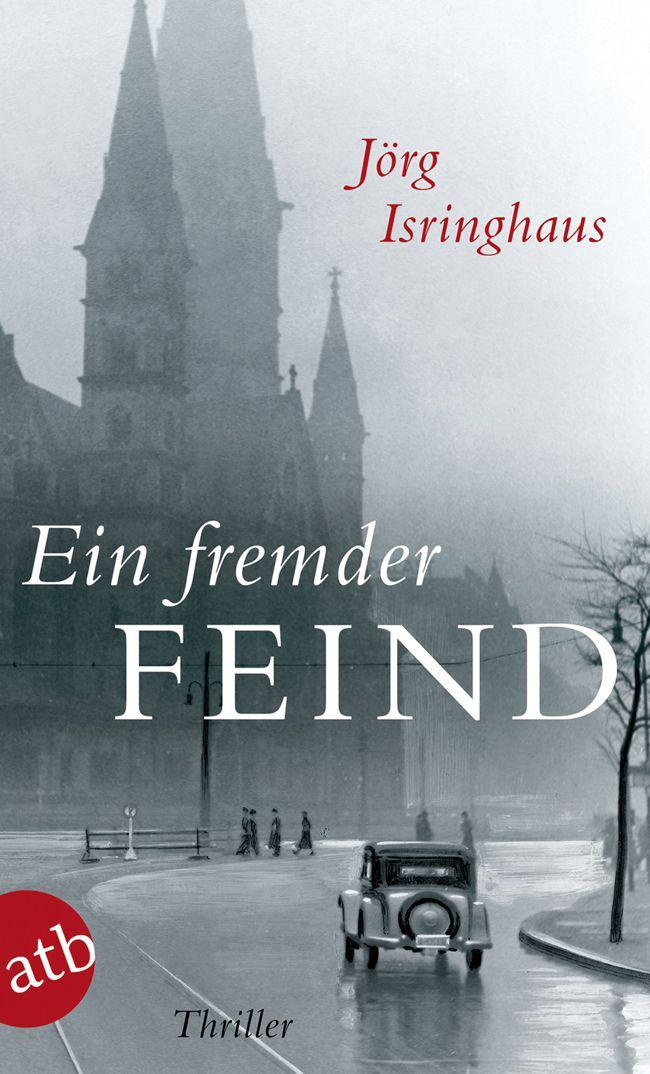![Ein fremder Feind: Thriller (German Edition)]()
Ein fremder Feind: Thriller (German Edition)
Krauss. Die Müdigkeit in ihrem Gesicht war verflogen.
»Ich habe das Gefühl dafür verloren, was gut und was böse ist. Was ist daran schlecht, ein Jude zu sein? Ich weiß es nicht. Jeder lebt mir vor, dass wir ein Stück Dreck sind. Aber wir sind es nicht, die Menschen zusammenschlagen, Häuser anstecken und einen Krieg führen. Das passiert im Namen der Guten, der einzig Wahren, der Herrenrasse. Diese Welt ist krank. Manchmal kommt es mir vor, als hätte man sie wie einen schmutzigen Socken auf links gezogen. Auf einmal ist alles falsch, was vorher richtig war. Es ist zum Verrücktwerden. Ohne Samuel wäre ich es längst, davon bin ich überzeugt. Er gibt mir die Kraft, das durchzustehen, obwohl er selbst an den Zuständen verzweifelt. Aber er ist ungeheuer stark, tief verwurzelt in einem Glauben, der in seiner Geschichte so vielen Anfeindungen ausgesetzt gewesen ist. Mir war das nicht bewusst, ich bin dem Ruf meines Herzens gefolgt. Sagen Sie mir bitte, was kann daran schlecht sein?«
Krauss antwortete nicht, weil er wusste, dass sie nichts hören wollte. Weinbergs Frau sprach weiter.
»Ich halte mich für jemanden, der Menschen einschätzen kann. Sie sind nicht einer von denen. Vielleicht waren Sie es einmal, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Sie sich damit auseinandersetzen. Und dass Sie versuchen, es wiedergutzumachen, auch wenn Sie behaupten, dass das nicht geht. Für mich macht das einen guten Menschen aus – jemand, der aus seinen Fehlern lernt. Ich wollte, es gäbe mehr Leute, die so sind wie Sie.«
Weinbergs Frau stockte.
»Ich weiß nicht, ob Straubinger es Ihnen erzählt hat, aber der Mann, den ich getötet habe, war mein Bruder«, sagte Krauss in die Stille, die zwischen ihnen entstanden war. Er wusste nicht, warum er das gesagt hatte. Es schien ihm, als wolle er ihrunbedingt beweisen, was für ein Ungeheuer er war. Er suchte keine Absolution, sondern Strafe. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich nicht.
»Das ist entsetzlich«, sagte sie. »Sie tun mir leid.«
»Das ist nicht nötig. Ich würde es wieder tun, obwohl es mir keinerlei Genugtuung verschafft hat. Nur die Gewissheit, dass er für seine Taten bestraft wurde. Mir geht es da so ähnlich wie Ihnen: Ich glaube, dass man auch die Gerechtigkeit auf links gezogen hat. Also muss man seinen eigenen Prinzipien folgen.«
Sie sah ihn traurig an.
»Ich halte Sie trotzdem nicht für einen schlechten Menschen«, flüsterte sie. »Vielleicht für einen verlorenen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.«
Weinbergs Frau lächelte, strich ihm über das Bein und erhob sich.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte sie. Er nickte. Als sie fast die Tür erreicht hatte, fiel Krauss noch etwas ein.
»Würden Sie mir einen Gefallen tun?«, fragte er. Sie blieb stehen und drehte sich um.
»Erlauben Sie Ihrer Tochter, mich zu besuchen. Sie war vorhin kurz hier, und ich finde sie wunderbar. Es würde mich auf andere Gedanken bringen.«
Krauss war nicht in der Lage, ihren Blick zu deuten, bevor sie die Tür wortlos hinter sich zuzog. Doch er konnte es gut verstehen, wenn sie ihrer Tochter den Kontakt mit einem Brudermörder nicht zumuten wollte.
Eine halbe Stunde später zupfte jemand an seiner Bettdecke. Er war nach dem Essen eingeschlafen, das Tablett vor sich.
»Ich soll das Geschirr abholen«, sagte die Kleine.
Er lächelte und reichte es ihr. Sie ging, kehrte aber kurz darauf zurück und stand unschlüssig neben dem Bett. Er rutschte ein Stück zur Seite.
»Setz dich«, sagte er. Sie zierte sich erst, setzte sich dann aber aufs Bett und verschränkte die Arme.
»Ich weiß noch gar nicht, wie du heißt«, sagte Krauss.
Sie machte einen spitzen Mund.
»Hannah«, sagte sie.
Krauss schluckte. Er hatte sofort einen Kloß im Hals, riss sich aber zusammen.
»Das ist ein schöner Name«, entgegnete er leise. »Ein sehr schöner Name.«
»Und wie heißt du?«, fragte Hannah keck.
Er rang sich ein Lächeln ab. »Richard«, sagte er. »Ich heiße Richard.«
7.
B RASILIEN
15. Dezember 1935
Dorf der Aparai
Niemals hätte Hansen gedacht, dass er im Dschungel mit seinen sexuellen Neigungen konfrontiert werden könnte. Doch jetzt hockte er im Rundhaus und beobachtete verstohlen Saracomano, den Häuptlingssohn. In den fünf Tagen, die sie jetzt bei den Aparai waren, hatte er sich mit dem Jungen angefreundet, besser gesagt, Saracomano mit ihm. Sie gingen gemeinsam auf die Jagd, der Indianer zeigte ihm ihre verborgenen Pfade, versuchte, den Weißen
Weitere Kostenlose Bücher